"Aktuell geht Manches viel schneller und leichter"
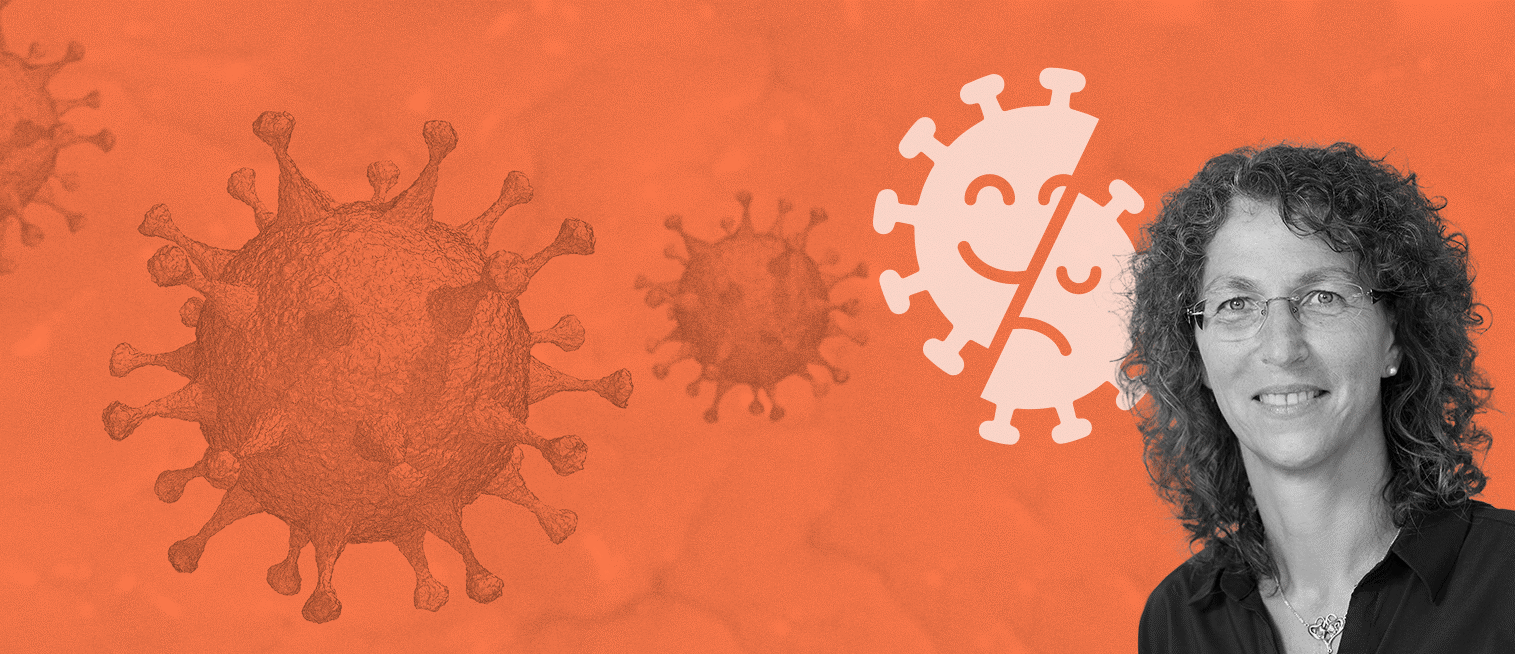
Prof. Dr. Daniela Lohaus ist Wirtschaftspsychologin im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften und Autorin mehrerer Fachbücher zu Themen des Human Resource Managements. Sie forscht vor allem zu Präsentismus, Arbeitgeberattraktivität und Talent Analytics. Aus ihrer Sicht hat die Corona-Krise neben Jobverlusten und finanziellen Einbußen auch einige positive Veränderungen der Arbeitsbedingungen bewirkt. Sie sieht aber auch die Sorgen und den Frust von Studierenden, die sich mehr Kontakt zu ihren Lehrkräften wünschen.
Ein Interview von Nico Damm, 14. August 2020
impact: Frau Lohaus, Sie sind Expertin für das Thema Präsentismus - das Phänomen, dass Menschen arbeiten gehen, obwohl sie krank sind. Damit schaden sie ihrer Gesundheit. Ist die Hürde, sich krank zu melden, zurzeit vielleicht niedriger, weil Viele ohnehin von zuhause aus arbeiten?
Lohhaus: Eher im Gegenteil: Wir erwarten, dass durch Homeoffice der Effekt verstärkt wird. Weil man sich zuhause ja wenigstens noch teilweise aufraffen kann und man andere nicht ansteckt. In vielen Organisationen ist es inzwischen auch schon so, dass gesagt wird: Auch wenn Sie krank sind, erwarten wir, dass Sie alle zwei, drei Stunden Ihre Mails abrufen. Präsentismus wird also zurzeit eher zunehmen. Natürlich nicht an Arbeitsplätzen in der Organisation, wenn die Situation rund um Covid-19 sich wieder zuspitzt. Es gab es ja zum Beispiel lange die Chance, ohne Arztbesuch und Rezept zuhause zu bleiben. Sicherlich nutzen das Einige aus. Aber tendenziell nimmt zurzeit die Angst um den eigenen Arbeitsplatz zu, weil viele Unternehmen in Schwierigkeiten sind und Arbeitsplätze abbauen. Und das führt erfahrungsgemäß zu Präsentismus.
impact: Welche positiven Effekte sehen Sie denn in der aktuellen Krise für Beschäftigte?
Lohaus: Vor allem den Fokus auf Arbeitsbedingungen - nicht nur in der Fleischindustrie. Es kommen auch Veränderungen zustande, die später nicht mehr zurückgenommen werden. Zum Beispiel flexiblere Modelle, was Arbeitszeit und Arbeitsort geht. Aber auch das Verbot von Werksverträgen. Friseure nehmen einen Corona-Zuschlag. Die könnten sicher nach dem Ende der Krise die Preise etwas absenken, aber vermutlich nicht auf das Niveau vor der Krise.
impact: Die Pandemie fordert alle. So gibt es auch neue Herausforderungen von Organisationen, für ihre Mitarbeiter zu sorgen. Gleiches gilt an Hochschulen für die Betreuung von Studierenden. TU-Studierende haben sich kürzlich öffentlich beschwert: Sie haben das Gefühl, in Zeiten von Corona nicht gut betreut zu werden. Wie entsteht dieser Frust und können Sie diesen verstehen?
Lohaus: Verstehen kann ich das auf jeden Fall. Aus Gesprächen mit Menschen an unserer und anderer Hochschulen weiß ich: Die Bandbreite ist sehr groß. Es gibt Lehrkräfte, die kümmern sich enorm um die Studierenden und für die ist das eine Sternstunde in Digitalisierung. Die probieren ganz viel Neues aus und geben sich extrem viel Mühe, die Studierenden zu versorgen und einzubeziehen. Auf der anderen Seite gibt es die, von denen man den Eindruck hat, die gibt es gar nicht mehr. An unserer Hochschule kann ich das nur bedingt beurteilen. Aber was ich aus Erzählungen von anderen Hochschulen und Universitäten mitnehme ist, dass manche gar nicht reagieren und gar kein Lehrmaterial zur Verfügung stellen. Oder sie stellen ihre alten Publikationen zur Verfügung, die eigentlich gar nichts mit dem Lehrstoff zu tun haben. Dann gibt es viel zwischendrin. Manche stellen ihr Folien-Skript zur Verfügung, aber keinen erläuternden Text, wie man ihn sonst in der Vorlesung hat. Die sagen dann: Erarbeitet es euch selber, es steht ja im Lehrbuch. Ich glaube, dass es Studiengänge gibt, wo alles zurzeit gut läuft und andere, wo es schlechter läuft. Ein Kollege hat mir erzählt: Sein Sohn studiert technische Informatik. Und keiner der Lehrenden hat es geschafft, etwas digital zur Verfügung zu stellen, das über das Hochladen des Skripts hinausgeht. Da entsteht totaler Frust, denn man denkt ja, dass die das besonders gut können müssten, zumindest das Technische. Selbst wenn die Lehrkräfte bemüht sind, etwas zur Verfügung zu stellen, ist es für die Studierenden dennoch schwierig. Denn viele Lehrende verwenden unterschiedliche Software. Die Interaktion ist total eingeschränkt. Beispielsweise habe ich manche Studierende, die haben an ihrem Rechner keine Kamera und das Mikrofon funktioniert nicht. Die können dann nur über den Chat teilnehmen. Da kann ich gut verstehen, dass sich Studierende alleingelassen fühlen, da ihnen ja auch der Austausch untereinander fehlt.
impact: Welche Unterschiede sehen Sie zwischen den Studiengängen, was die aktuelle Situation angeht? Manche erfordern sicherlich viel mehr physische Präsenz…
Lohaus: Für die gestalterischen Studiengänge ist es zurzeit besonders problematisch. Sie sind ja besonders auf Manuelles angewiesen. Da stellt man sich seine Werke gegenseitig vor und erläutert sie. Innerhalb unseres Studiengangs, der Wirtschaftspsychologie, ist es schwierig, wenn es in die Kleingruppen geht. Dort bearbeiten die Studierendenden Projekte extrem selbstständig und eigeninitiativ. Das ist natürlich virtuell besonders schwierig. Es geht überall ganz gut, wo der Fokus auf Vorlesungen liegt. Die lassen sich recht gut digitalisieren. Und ich denke auch, dass es eigentlich dort leichter sein sollte, wo die Studierenden technisch affiner sind. Da sollten Studierende und Lehrende technisch auch besser ausgestattet sein. Und dort, wo man traditionell weniger mit Digitalisierung zu tun hatte, ist es sicher viel schwieriger. Studiengänge, die eine psychologische Komponente haben oder auf eine bestimmte Form von Kommunikation ausgerichtet sind, bemühen sich vielleicht etwas mehr, den Kontakt zu halten. Denn sie wissen, wie wichtig der menschliche Kontakt ist. Das ist vielleicht ein Vorteil gegenüber den technischen Fächern.
impact: Welche weiteren Schwierigkeiten sehen Sie in der aktuellen Situation für die Studierenden?
Lohaus: Ich sehe vor allem Schwierigkeiten darin, dass die soziale Schere größer werden wird. Diejenigen, die sehr selbstdiszipliniert und organisiert sind, kommen besser zurecht. Da gibt es sogar welche, die sagen: Es ist jetzt viel besser, ich kann mir viel freier meine Zeit einteilen. Die können sich die Vorlesung anschauen, wenn es ihnen gerade am besten passt. Es gibt aber auch viele, die nicht so selbstdiszipliniert sind, technische Probleme haben oder es leben mehrere Personen im Haushalt, die gleichzeitig auf das Internet zugreifen. Dann gibt es Störungen. Oder sie haben keinen angemessenen Arbeitsplatz, wo sie ungestört arbeiten können. Wenn nicht so feste Zeiten vorgegeben sind wie normalerweise, besteht für einige ein viel größerer Anreiz, zum Beispiel zu arbeiten anstatt zu lernen. Die sagen dann: Die Vorlesung schaue ich mir heute Abend an, aber dann sind sie nach der Arbeit zu müde. Auf der anderen Seite muss ich sagen: Mein Eindruck von der aktuellen Klausur, die ich gerade korrigiere, ist, dass sie genauso gut ausfallen wird wie die bisherigen. Also denke ich, die Studierenden haben es geschafft, alles zu kompensieren. Die meisten haben aktuell Corona-bedingt mehrere Wochen Pause zwischen dem Ende der Vorlesungen und den Klausuren. Dazu haben Einige gesagt: Das ist super, da habe ich mehr Zeit zu lernen als in anderen Semestern. Aber mal ehrlich: Wie viele lernen denn dann in dieser Zeit? Nach einer längeren Pause ist es dann vielleicht noch schwieriger, sich auf den einzulassen.
impact: Wo wurde die Klausur geschrieben?
Lohaus: An der Hochschule. Die Studierenden waren extrem diszipliniert. Einige von ihnen habe ich das erste Mal überhaupt persönlich getroffen.
impact: Gibt es denn aus der Psychologie Erkenntnisse, ob es einen Unterschied macht, wo ich meine Klausuren schreibe?
Lohaus: Aus der Kognitionspsychologie kennen wir die sogenannte Enkodierungsspezifizät. Das heißt, der Kontext, in dem ich lerne, sollte möglichst gut dem Kontext entsprechen, in dem ich das Wissen abrufe. Insofern könnte es aus Sicht von Studierenden sogar Vorteile haben, wenn sie zuhause lernen und die Prüfung dann ebenfalls online stattfindet. Ein typisches Beispiel ist: Jemand lernt auf der Couch im Liegen und schreibt die Klausur dann aber auf einem Stuhl im Sitzen. Das kann schon schlechter funktionieren. Andererseits können sich manche in einem Prüfungskontext besser konzentrieren. Zuhause zu sitzen hat ja auch Aspekte von Freizeit, da gibt es Ablenkung. Da konzentriere ich mich vielleicht nicht so gut. Das ist ein wenig typenabhängig.
impact: Es gibt ja auch psychologische Forschung, die zeigt, dass Menschen sich Dinge besser merken können, die sie in analoger Form wahrnehmen, also etwa ein Ausdruck anstatt ein Text auf dem Monitor. Spielt das für Ihre Lehre eine Rolle?
Lohaus: Die Studierenden müssen da selbst Wege finden, wie sie das am besten machen. Generell gilt: Wenn ich etwas Ausgedrucktes lese, dann kann ich viel mehr auf einmal erkennen. Ich kann die Struktur eines Textes viel besser sehen. Ich weiß: War die Stelle in der Mitte meines Buches oder stand das rechts oben? Auf dem Bildschirm sehe ich nur Ausschnitte und habe diese örtlichen Anker nicht für das Gehirn. Das kann es tatsächlich schwieriger machen, sich etwas zu merken. Auch Sequenzielles kann ich analog viel besser erfassen als online.
impact: Wo sehen Sie die Herausforderungen für die Beschäftigten - allgemein und an Hochschulen?
Lohaus: Für die Beschäftigten sind die Herausforderungen gerade enorm. Wir haben das ja am Anfang mitgekriegt, als es hieß: Diejenigen, die zur Risikogruppe gehören oder gefährdete Angehörige haben, können zuhause bleiben. Das heißt natürlich, dass diejenigen, die da sind, das kompensieren müssen. Dann haben wir die Situation, dass von der Hochschulleitung ganz viel Corona-Kommunikation kommt. Die muss aufgenommen und verarbeitet werden. Das bedeutet ganz viel Verantwortung, denn es will ja keiner einen Fehler machen und andere gefährden. Das Personal, das viel mit Studierenden zu tun hat, hat viel mehr Anfragen als sonst. Die Studierenden sind verunsichert und haben besondere Fragen. Das Arbeitsvolumen hat sich also deutlich verstärkt. Und es gibt keine Routinen. Auch da haben wir weniger Effizienz. Und viele haben das A-B-System. Ich kenne auch viele, die sind zuhause gar nicht darauf eingerichtet, im Home Office zu arbeiten. Bei den ProfessorInnen ist das kein Thema: Die haben zuhause alle ihren Arbeitsplatz und sind es sowieso gewöhnt, viel von dort zu arbeiten. Aber ich sehe KollegInnen, die am Küchentisch arbeiten. Die sitzen dann den ganzen Tag auf einer harten Holzbank und die Ergonomie bleibt auf der Strecke. Die müssen mit Ablenkung durch die Familie rechnen und kämpfen teils mit technischen Problemen. Die Herausforderungen für das nicht-lehrende Personal sind also größer.
impact: Es gibt ja große individuelle Unterschiede zwischen Menschen, die durch die Pandemie deutlicher zutage treten. Extrovertierte litten oft sehr unter den strengeren Kontaktbeschränkungen, während für Introvertierte das Leben deutlich einfacher schien. Gibt es denn ein Minimum an menschlicher Interaktion, für die Hochschulen oder Arbeitgeber sorgen müssen?
Lohaus: Es gibt ein Minimum. Wir wissen, dass Menschen in völliger Einsamkeit depressive Züge entwickeln. Der Mensch ist auf Gemeinschaft angewiesen. Im privaten Umfeld kann man das ausgleichen. Ich persönlich finde die Situation zurzeit optimal, denn ich kann zuhause sowieso viel besser arbeiten. Ich komme an die Hochschule für die Lehre und zum Socializing. Ich weiß aber auch von Kollegen, denen das total viel ausmacht. Die kommen bewusst an die Hochschule, um andere Menschen zu treffen. Regelmäßige Teammeetings sind zurzeit deshalb sehr wichtig - auch virtuell. Auf jeden Fall auch mit Video, damit man sich gegenseitig sieht. Das halte ich für eine der dramatischen Änderungen zurzeit: Dass wir durch den fehlenden visuellen Kontakt in unserer Kommunikation extrem eingeschränkt sind. Wir sind darauf angewiesen, die Mimik und die Gestik von anderen zu lesen. Die Gefahr von Missverständnissen ist deshalb zurzeit viel größer und wir müssen viel mehr auf der Meta-Ebene kommunizieren. Mir geht das auch so, wenn ich von zuhause aus meine Vorlesungen halte. Da erkläre ich ganz viel, wie ich etwas meine. Denn ich weiß: In meinem Tonfall bin ich oft sehr bestimmt. Vor Ort sehen die Studierenden aber etwa, dass ich dabei lächle und können das einordnen. Das fehlt ihnen jetzt völlig und mir fehlt auch die Rückkopplung, zumindest von diejenigen, die mir nur zuhören.
impact: Es wird ganz viel darüber spekuliert, dass wir aktuell bereits das Arbeitsmodell der Zukunft ausprobieren. Macht Ihnen das Sorge vor dem Hintergrund der vielen möglichen kommunikativen Missverständnisse?
Lohaus: Wir werden besser darin, mit dieser Form der Kommunikation umzugehen. Wir brauchen aktuell mehr Zeit, weil wir mehr auf der Meta-Ebene verbringen und erklären müssen, wie etwas gemeint ist. Das kann aber durchaus von Vorteil sein, weil es ja auch eine bewusste Form der Kommunikation ist. Ich sehe durchaus Chancen darin: In der Wirtschaft sind ja viele im Home Office. Dadurch sind viele Freiräume entstanden, denn es arbeiten jetzt auch viele Menschen zuhause, denen man das bisher verweigert hat. Für die ist das klasse, denn sie haben ja gezeigt, dass es geht. Das lässt sich später auch nicht mehr zurücknehmen. Aber wir müssen an das vorher Gesagte anknüpfen: Wir brauchen die technischen Voraussetzungen und einen ergonomischen Arbeitsplatz. Viele arbeiten effizienter. Sie haben die Arbeitswege nicht mehr. Sie können ihre Arbeit etwas über den Tag verteilen. Sie können zwischendurch mal das Kind in die Kita bringen oder die Waschmaschine anstellen. Darin, die Arbeit und das Leben besser zu vereinbaren, darin sehe ich enorme Vorteile. Außerdem haben wir bereits jetzt weniger Staus und eine bessere Luft. Über die Risiken haben wir ja schon gesprochen: Vereinsamung durch Mangel an Kommunikation und die Benachteiligung jener, bei denen die räumlichen Voraussetzungen nicht stimmen.
impact: Mein Eindruck ist: Der öffentliche Dienst holt zurzeit wieder sehr verstärkt die MitarbeiterInnen an die Arbeitsstelle zurück, während die freie Wirtschaft weiter auf Home Office setzt. Teilen Sie diese Beobachtung und falls ja, was sind die Gründe dafür?
Lohaus: Teilweise ist das auch mein Eindruck. Innerhalb der Wirtschaft wird ja viel stärker über Ziele geführt. Wenn ich sehe: Jemand erreicht seine Ziele, kann mir es relativ egal sein, von wo aus die Person arbeitet. Der öffentliche Dienst hingegen ist noch stärker zeit- und aufgabenorientiert. Viele haben eine bestimmte Aufgabe, und es wird nicht immer gemessen, wie effektiv sie erledigt wird. Vielfach ist die einzige Messgröße die Anwesenheitszeit. Wenn ich diese Orientierung habe, muss ich natürlich sicherstellen, dass die MitarbeiterInnen ihre Arbeitszeiten einhalten. Allerdings holen auch schon manche Unternehmen ihre Leute zurück. Dort, wo ich mit Führungskräften sprechen kann, höre ich, dass diese das tun, weil sie denken, ihre MitarbeiterInnen brauchen das. Weil sie dann den Kontakt und Austausch haben und weil ihre Arbeitssituation zuhause nicht optimal ist.
impact: Was wäre denn ihre Empfehlungen an Hochschulen? Wie können sie sicherstellen, dass wir für die Gesundheit der Beschäftigten sorgen, andererseits aber auch in Sachen Effizienz besser werden?
Lohaus: Was die Lehre anbelangt, haben wir extrem gute Ansätze. Das hochschuldidaktische Zentrum an der h_da macht einen sehr guten Job. Was die an Angeboten auf die Beine gestellt haben und in der jetzigen Situation an Support bieten, ist großartig. Ich glaube, dass aus deren Sicht die Situation günstig ist. Jetzt werden Angebote, die sie teils seit vielen Jahren machen, viel stärker angenommen.
impact: Was gehört zu diesen Angeboten?
Lohaus: Es spricht zum Beispiel seit Jahren gezielt Lehrende an, ob sie ihre Vorlesungen aufzeichnen wollen, um diese den Studierenden dann digital zur Verfügung zu stellen. Ich selbst habe das früher nie gemacht, weil ich dachte: Da bin ich verkrampft und nutze keine Beispiele mehr aus meinen Erfahrungen mit realen Unternehmen - weil dann alles dokumentiert ist. Und wenn ich mich verspreche, ist das auch doof. Aber jetzt zeichne ich alle Vorlesungen im Vorfeld auf, bearbeite sie selbst und stelle sie dann ein. Das ist allerdings ein Riesen Aufwand. Das hochschuldidaktische Zentrum stellt Anleitungen zur Digitalisierung der Lehre zur Verfügung, bietet regelmäßig Sprechstunden und Weiterbildung an und vieles mehr.
impact: Was ist denn Ihr Tipp für die Hochschulleitungen allgemein? Wie kann man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zufrieden halten?
Lohaus: Jetzt ist die Zeit, zu analysieren, was gut gelaufen ist. Dort, wo die Beschäftigten im Homeoffice gut zurechtgekommen sind, ist es ganz wichtig, dass man das beibehält. Weil das einfach eine bessere Work-Life-Balance bedeutet, weil ich meine Arbeit besser an meinen Biorhythmus anpassen kann und leichter mit privaten Verpflichtungen vereinbaren kann. Was wir hinkriegen sollten ist, Prozesse zu verschlanken. Das sieht man ja aktuell schon: Durch Corona geht Manches auf einmal viel schneller und leichter. Zum Beispiel kann man Dokumente digital schicken statt analog in mehrfacher Ausführung. Kann man das nicht einfach beibehalten?
impact: Wie kann man aktuell für eine abwechslungsreiche Lehre sorgen - auch im Hinblick auf das kommende Wintersemester, das ja vielerorts sowohl vor Ort als auch digital stattfinden soll?
Lohaus: Abwechslungsreiche Lehre stelle ich mir so vor, dass man den Studierenden nicht nur Material zur Verfügung stellt wie zum Beispiel Skripte. Ich bin großer Fan von aufgezeichneten Lehrveranstaltungen geworden. Der Stoff wird komplett im Vorlesungs-Video behandelt. Meine Studierenden lesen das Skript vor der Veranstaltung und diese ist dann nur noch für Fragen da. Jetzt nutzen wir die Zeit viel besser und wir sind viel interaktiver. Natürlich stellt das hohe Anforderungen an die Selbstdisziplin. Es muss aber auch Chancen für Kontakt geben. Meine KollegInnen sind da zum Teil sehr kreativ: Die machen zum Beispiel zwischendrin mal ein Quiz im Multiple-Choice-Format und am Ende sehen alle, wie viele für welche Antwort gestimmt haben. Viele Konferenz-Softwares bieten auch die Möglichkeit, die Gruppe aufzuteilen, sodass in Kleingruppen gearbeitet werden kann. Das braucht extrem viel Zeit, aber es ist eine Chance für mehr Kontakt. Ein Kollege nutzt eine Software, mit der man sehr gut visualisieren kann: Da kann man zum Beispiel an Pinnwänden arbeiten - wie in einem echten Workshop. Wichtig finde ich es auch, ab und an das Format zu wechseln. Also manchmal den Chat, dann beim nächsten Mal wieder Video. Schriftliche Antworten sind für den Lerneffekt manchmal wichtig. In anderen Situationen ist es praktischer, schnell mal eine Frage per Mikrofon stellen zu können. Eine Kollegin erstellt mit Hilfe einer Hilfskraft Mini-Video-Tutorials und regt ihre Studierenden dazu an, selber Podcasts und Videos zu machen. Die zählen dann wiederum als Leistung in ihren Seminaren. Das erhöht die Medienkompetenz und die Vielfalt.
impact: Was sollte an Hochschulen unbedingt vor Ort stattfinden?
Lohaus: Wichtig ist vor allem, dass die Veranstaltungen vor Ort gebündelt werden. Es ist nicht zumutbar, dass wir die Studierenden jeden Tag nur für einen kleinen Block an die Hochschule holen. Für uns liegt der Fokus auf den Studierenden im ersten Semester. Die hatten noch keine Chance, sich kennen zu lernen. Wenn das nicht passiert, dann ist ein extrem großer Teil des studentischen Lebens und Zusammenhalts gefährdet. Wir werden also versuchen, die Einführungsveranstaltungen, die zum Teil vor Vorlesungsbeginn stattfinden, teilweise an der Hochschule durchzuführen. Wir überlegen auch, die Projektveranstaltungen vor Ort anzubieten, denn dort arbeiten die Studierenden in Kleingruppen zusammen. Im Sommersemester kann man natürlich überlegen, Vorlesungen draußen zu machen. An meiner alten Hochschule gab es zum Beispiel draußen tribünenartige Sitzreihen aus Holz. Möglich wäre natürlich auch, dass nur ein Teil der Studierenden präsent ist, während die anderen online teilnehmen. Bei uns reicht in den Räumen der Platz auch gar nicht dafür aus, wenn wir die Hygiene-Auflagen erfüllen wollen. Wichtig ist Präsenz natürlich auch bei Laborveranstaltungen oder bei manuellen Tätigkeiten wie in der Gestaltung.
impact: Universitäten haben ja in der Regel viel mehr Studierende pro Lehrkraft. Sehen Sie in der Pandemie die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften klar im Vorteil?
Lohaus: Ich glaube schon. Aus individuellen Berichten habe ich den Eindruck, dass sich die Studierenden an Universitäten zurzeit öfter beschweren, dass zu wenig läuft oder zu spät angelaufen ist. Hypothese: Das könnte daran liegen, dass wir hier an der HAW aufgrund der kleineren Jahrgänge sowieso ein engeres Verhältnis zu den Studierenden haben und es vielleicht viel schneller ein schlechtes Gewissen erzeugt, wenn man die Studierenden im Stich lässt. Es gibt aber sicher viele Universitäten, die das gut gelöst haben.
Kontakt
Nico Damm
Hochschulkommunikation
Tel.: +49.6151.16-37783
E-Mail: nico.damm@h-da.de