"Ich habe noch nie so oft den Himmel fotografiert"
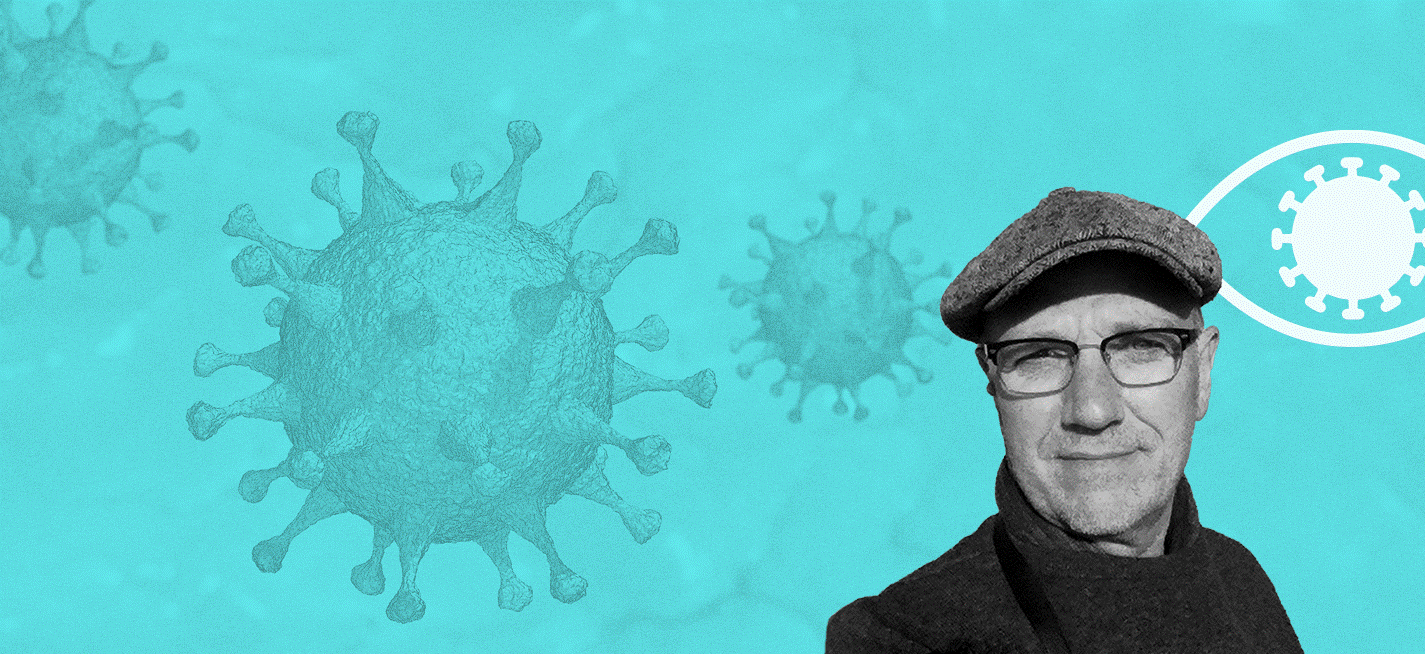
Professor Michael Kerstgens lehrt Fotografie am Fachbereich Gestaltung der Hochschule Darmstadt (h_da). Im impact-Interview erklärt er, wie die Corona-Pandemie unsere Wahrnehmung verändert, welche Bilder ihn besonders beeindrucken und was es mit der „Instagramisierung“ der Fotografie auf sich hat.
Ein Interview von Christina Janssen, 14. Dezember 2020
impact: Herr Kerstgens, hat die Pandemie ihre eigene Ikonographie?
Kerstgens: Nein, dafür ist es wohl noch zu früh. All die Bilder von Masken auf dem Boden – das ist fotografisch nicht relevant. Die Masken sind die neuen Cola-Dosen: Müll.
impact: Was fehlt Ihnen in der Corona-Bilderflut?
Kerstgens: Zum Beispiel künstlerisch herausragende Portraits: Da sind Augen, in die man schaut, man sieht die Last der Menschen, man sieht die Verzweiflung, man sieht, da ist eine inhaltliche Tiefe drin. Deshalb werden ja auch nur wenige Bilder zu Ikonen.
impact: Welche zum Beispiel...?
Kerstgens: Ein Beispiel ist das Fotoprogramm der Farm Security Administration in den USA in den 1930er Jahren. Im Mittleren Westen gab es während der „Great Depression“ große Not unter den Farmern. Die Regierung setzte deshalb ein Hilfsprogramm auf und schickte Fotografen in die Region, um die Krise zu dokumentieren. Einige der Bilder, die damals entstanden, sind zu Ikonen geworden. Etwa das berühmte Foto von Dorothea Lange – eine Mutter mit ihren zwei Kindern auf dem Arm.

Kerstgens: Dieses Bild steht für seine Zeit. So wie vielleicht das Bild von Mitterrand und Helmut Kohl Hand in Hand in der Normandie oder Willy Brandts Kniefall in Warschau. Vielleicht wird irgendwann ein tolles Merkel-Bild mit Maske zu einer Ikone der heutigen Zeit werden. Vielleicht ist das Corona-Foto einfach noch nicht entstanden. Oder es schlummert irgendwo und hat seine Wirkung noch nicht entfaltet.
impact: Zurzeit bleiben uns oft nur Bilder, um sich mit anderen zu verbinden. Erhalten Fotos in der Pandemie eine neue Bedeutung?
Kerstgens: Auf eine gewisse Weise schon: Wenn der Großvater oder die Patentante jetzt wieder in Fotoalben blättern und noch mehr Fotos über Whatsapp oder Facebook geteilt werden, dann hat das für die Menschen natürlich eine Bedeutung – als Erinnerungs- oder Teilhabeinstrument. Insgesamt sehe ich die Entwicklung der Fotografie aber problematisch: Bilder sind omnipräsent und in Massen verfügbar. In den sozialen Medien gehen Fotos „viral“ – und sie gleichen sich alle. Ich nenne das die „Instagramisierung“ der Fotografie.
impact: Sie meinen, quantitativ nimmt die Bedeutung von Bildern zu, qualitativ erleben wir aber einen Rückschritt?
Kerstgens: Ja, absolut. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen: Das zieht sich bis in die internationale zeitgenössische Kunstszene durch.
impact: Wieso?
Kerstgens: In den 1980er Jahren sind die Schüler des Künstler-Ehepaars Bernd und Hilla Becher an der Düsseldorfer Kunstakademie berühmt geworden und haben den Fotomarkt mit ihren großen Formaten geprägt. Diese neue Art zu fotografieren wurde schnell zu einem Label. Und natürlich haben diese Fotografen ihren Platz in der Kunstgeschichte. Das Problem sind die vielen Nachahmer. Der renommierte Fototheoretiker Klaus Honeff beklagt, dass die Fotografie unheimlich abgeflacht ist, weil erfolgreiche Positionen – leicht variiert – immer wieder neu aufgenommen werden. Da geht es mehr um die Ästhetik als um den Inhalt. Ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Für mich steht die gesellschaftliche Relevanz eines Bildes an erster Stelle.
impact: Sehen wir die nicht in den typischen Corona-Motiven – die Masken, die menschenleeren Straßen... Welche Botschaften transportieren diese Bilder?
Kerstgens: Wenn ich zurzeit die Nachrichten sehe und Bilder aus aller Welt von Menschen mit Masken, dann ist die Botschaft: Alle sind betroffen, unabhängig von Politik oder Macht. Und ich frage mich wirklich, warum die sogenannten „Querdenker“ nicht begreifen, welche Ausmaße diese Pandemie hat. Auch wenn man sich die Todeszahlen ansieht… Corona ist ja auch eine Geschichte der Zahlen, vielleicht noch mehr als eine Geschichte der Bilder.
impact: Ich möchte aber mit Ihnen bei den Bildern bleiben.
Kerstgens: Ja, ich weiß. Aber durch die Dominanz der Zahlen wird das Bild zur Illustration. Solange die Zahlen im Vordergrund stehen, können sich die Bilder vielleicht auch nicht durchsetzen.
impact: Aber reagieren wir nicht auf Bilder emotional stärker als auf Zahlen?
Kerstgens: Das schon. Wenn man sich die Bilder aus Italien vom Frühjahr anschaut oder von menschenleeren Straßen in Madrid, die Massengräber in New York oder Verstorbene, die in Kühllastern aufbewahrt werden (schnappt nach Luft) … ja, da stockt einem der Atem. Das sind die Fotos, die bei mir ankommen. Das ist schlimm. Aber das hat schon wieder etwas so Schmerzhaftes, dass der Mensch es verdrängt. Dann bleibt man lieber bei der Maske auf dem Boden. Das tut nicht so weh.
impact: Kunst soll aber auch mal weh tun, oder?
Kerstgens: Ja, aber die Leute wollen nicht, dass man ihnen weh tut. Dann sind sie nämlich keine Konsumenten mehr, sondern Betroffene. Damit kommen die Menschen in der Pandemie noch gar nicht klar, dass sie unabhängig von Einkommen, Herkunft oder Region einfach selbst Betroffene sind. Das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung.
impact: Gibt es auch Corona-Bilder, die etwas Hoffnungsvolles haben? Flugzeuge bleiben am Boden, die Natur erobert Raum zurück…
Kerstgens: Ich beobachte tatsächlich, dass der Himmel anders aussieht. Es gibt weniger Kondensstreifen und dadurch vielleicht auch weniger oder eine andere Art der Wolkenbildung. Ich habe noch nie so oft den Himmel fotografiert wie zurzeit.
impact: Dann gibt es ja so etwas wie einen „Corona-Himmel“.
Kerstgens: Ja, ich bin allerdings kein Meteorologe (lacht). Ich sollte mit solchen Aussagen lieber vorsichtig sein.
impact: Als Künstler doch nicht!
Kerstgens: Also, für mich gibt es den Corona-Himmel. Das fand ich den ganzen Sommer über faszinierend. Aber vielleicht ist es auch nur eine andere Sichtweise, eine Sensibilisierung. Vielleicht hat man einfach mal mehr Lust, nach oben zu gucken.
impact: Stichwort Sensibilisierung: Ich beobachte an mir selbst, dass ich inzwischen empfindlich auf Fotos oder auf Filmszenen reagiere, in denen Menschen sich nahekommen, sich umarmen oder küssen. Unsere Wahrnehmung von Bildern verändert sich.
Kerstgens: Ja, das kenne ich auch – wenn ich zum Beispiel Bilder von Konzerten vom letzten Jahr sehe oder an mein letztes eigenes Konzerterlebnis denke. Ich kann es mir im Moment nicht mehr vorstellen, so etwas unbeschwert zu genießen. Es befremdet uns, sich nahezukommen – oder nur daran zu denken, wie andere sich nahekommen.
impact: Und was macht das mit Ihnen als Fotograf, mit Ihren Kolleginnen und Kollegen?
Kerstgens: Das sieht man zum Beispiel in den Tagesthemen oder im Heute Journal. Man sieht da, unter welchen Bedingungen die Pressefotografen in der Bundespressekonferenz jetzt arbeiten müssen. Wenn ich selbst rausgehe in leere Städte, fotografiere ich zurzeit weniger. Ich stelle dann vielleicht sogar ein Stativ auf und entschleunige meine Arbeit ein bisschen. Dann läuft da im Hintergrund jemand durchs Bild und man fragt sich, ob das nun gut oder schlecht ist. Die gegenwärtige Situation betrifft alle Bereiche, auch in der Fotografie.
impact: Wie gehen Sie in der Lehre damit um?
Kerstgens: Mit meinen Studierenden behandle ich in diesem Semester das Thema Freizeit, und sie tun sich gerade extrem schwer, geeignete Themen zu finden. Ich habe ihnen vorgeschlagen, etwas über Leute zu machen, die sich ehrenamtlich engagieren, die bei einer Tafel arbeiten, als Trainer in einem Sportverein, die bei Fridays for Future mitmachen. Aber das Problem ist: Fotografie ist auch ein räumlicher Prozess. Ich gehe rein in eine Situation und wieder raus. Ich gehe auf Menschen zu und nähere mich ihnen an. Und genau damit tun sich die jungen Leute – auch unabhängig von Corona – heute schwer. Das beobachte ich schon seit einigen Jahren. Auch das hat meines Erachtens mit den sozialen Medien zu tun: Da ist alles sehr unverbindlich und distanziert. Man geht nicht mehr direkt auf Menschen zu, sondern kommuniziert über das Display.
impact: Sind Sie so ein Kulturpessimist?
Kerstgens: Nein, überhaupt nicht. Ich habe auch schon mal zu einer Studentin gesagt: Um dein Talent beneide ich dich! – Das ist auch noch nicht so lange her. Aber das Fotografieren hat auch etwas mit Persönlichkeitsbildung zu tun, mit gesellschaftlichem Engagement und einem Blick für die Relevanz von Themen. Da geht zurzeit viel verloren. Aber damit müssen wir eben leben.
Weiterführende Links
Website von Michael Kerstgens: www.kerstgens.de
Fotoprojekt von Michael Kerstgens: Der Letzte Winter der Sowjetunion
Jüdisches Museum Berlin: Michael Kerstgens, Fotograf
Website h_da-Fachbereich Gestaltung: www.fbg.h-da.de/
Das Thema in den Medien
Deutschlandfunk, 16.10.2020: „Fotografie und Macht“
Der Standard, 12.6.2020: „Ikonografie einer Krankheit“
Neue Zürcher Zeitung, 10.4.2020: Die Corona-Krise in Bildern
Universität Wien, 11.5.2020: Die Bildsprache des Corona-Virus
Kontakt
Christina Janssen
Wissenschaftsredakteurin
Hochschulkommunikation
Tel.: +49.6151.16-30112
E-Mail: christina.janssen@h-da.de









