"Achtsame Deglobalisierung"
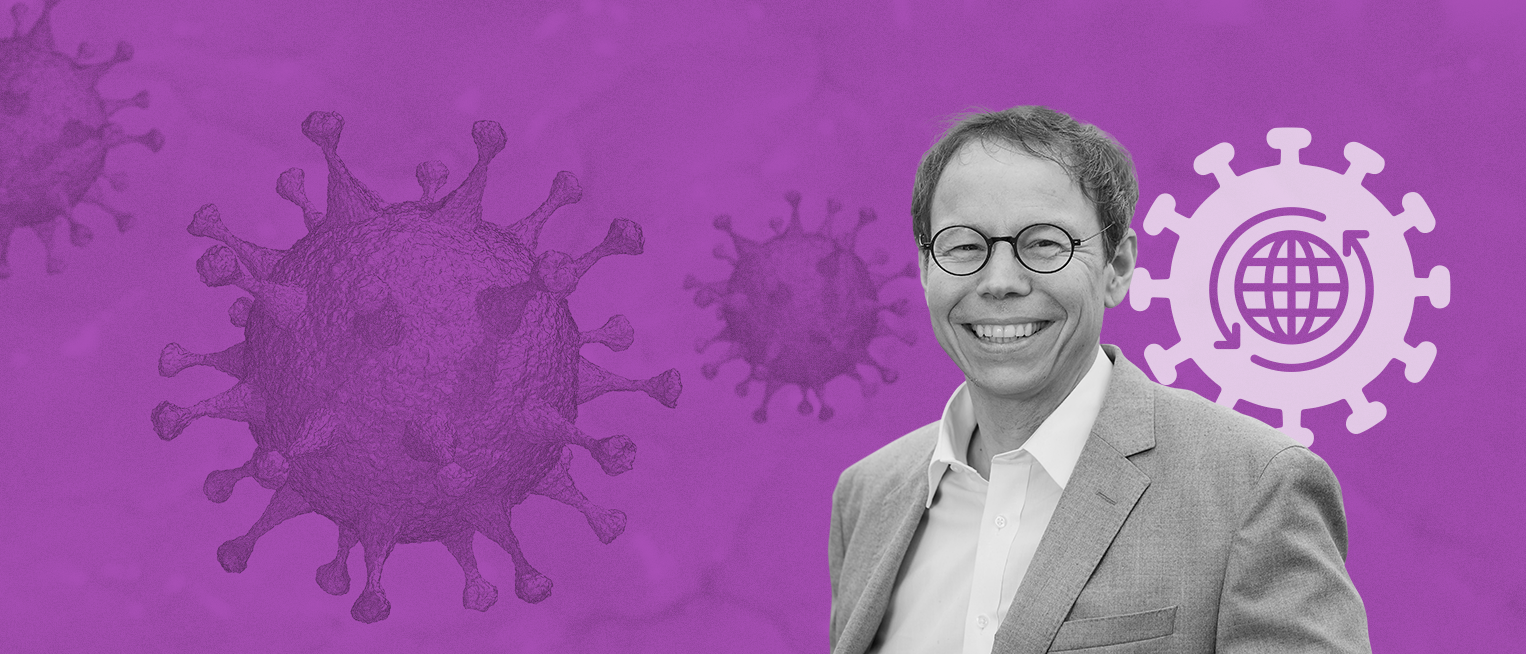
Ulrich Klüh ist seit 2015 Professor für Volkswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Makroökonomik und Wirtschaftspolitik an der Hochschule Darmstadt. Nach seinem Studium in Frankfurt am Main und Berkeley promovierte er an der LMU München zum Thema Finanzkrisen. Er arbeitete als Volkswirt beim Internationalen Währungsfonds in Washington, D.C., und als Generalsekretär beim Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Klüh ist Sprecher des Zentrums für Nachhaltige Wirtschafts- und Unternehmenspolitik. Im impact-Interview plädiert er für eine „achtsame Deglobalisierung“ und die Einführung einer Vermögenssteuer.
Ein Interview von Christina Janssen, 5. Oktober 2020
impact: 1972 warnte der Club of Rome in seinem Bericht „Die Grenzen des Wachstums“, einem Schlüsseldokument der Umweltbewegung, vor den Folgen von Ressourcenverbrauch und Bevölkerungswachstum. Hat uns Corona ein halbes Jahrhundert später endlich wirklich wachgerüttelt?
Klüh: Ich warne davor, vorschnell zu behaupten, die Corona-Pandemie verändere unsere Gesellschaft nachhaltig. Darüber wird derzeit viel spekuliert, aber letztlich wissen wir noch zu wenig. Ich würde es auch aus demokratietheoretischen Gründen für gefährlich halten, sich von einer Pandemie in eine gewisse Richtung treiben zu lassen. Das gilt für Nachhaltigkeitsthemen, vor allem aber auch für Fragen der Digitalisierung.
impact: Die Corona-Pandemie verstärkt allerdings politische und gesellschaftliche Trends, die schon vorher erkennbar waren.
Klüh: Ja, das bestimmt. Das betrifft durchaus auch Themen, die mich in meiner Forschung beschäftigen. Da ist erstens die Frage, welche Rolle marktbasierte im Vergleich zu alternativen, meist durch staatliche Stellen koordinierte Steuerungsmechanismen spielen. Da gibt es seit einiger Zeit eine klare Verschiebung zugunsten der staatlichen Seite. Und diese Verschiebung wird durch Covid verstärkt. Das zweite Thema ist, dass der Nationalstaat in den letzten Jahren wieder an Bedeutung gewonnen und die Globalisierung an Dynamik verloren hat. Es kommt zu einer Art De-Globalisierung. Auch das wird durch Covid verstärkt. Und das dritte Thema ist eben Wachstum. Hier hatten wir schon einen negativen Trend, und der ist durch Covid noch einmal verstärkt worden.
impact: Da haben wir also den „starken Staat“, nach dem viele derzeit rufen. An welchen Beispielen lässt sich das festmachen?
Klüh: Ein Beispiel ist das Gesundheitssystem, in das der Staat nun deutlicher eingreift. Dann natürlich die Rettungs- und Konjunkturprogramme und die damit verbundene, längst überfällige Aufgabe der schwarzen Null. Das alles wäre nicht so schnell gegangen, wenn es nicht schon vorher einen Trend gegeben hätte. Aber Covid macht eben sehr deutlich, dass für viele gesellschaftliche Probleme der Markt keine befriedigenden Lösungen bereithält und es ein starkes Gemeinwesen braucht.
impact: Interveniert die Bundesregierung auf eine Weise, die Sie für sinnvoll halten?
Klüh: In meiner Brust schlagen da zwei Herzen. In einer schwierigen Situation hat die Politik vieles richtig gemacht, aber natürlich nicht alles – Stichwort Solo-Selbstständige und andere Berufsgruppen. Immer noch unterschätzt die Politik die dramatischen Implikationen der Pandemie für das Thema Verteilung. Womit ich aber vor allen Dingen ein Problem habe, ist das Selbstverständnis, mit dem der Staat vorgeht. Wenn der Staat Konzerne rettet, sollte er auch Einfluss nehmen und beispielsweise fragen: Wie kann ich meine Beteiligung an der Lufthansa, meine Subventionen für die Automobilindustrie und die schon immer vorhandene Beteiligung an der Deutschen Bahn nutzen, um ein nachhaltiges, ökologisches Mobilitätskonzept durchzusetzen? Da dürfte der Staat sich mehr zutrauen. Öffentliche Akteure müssen zum zentralen Antreiber und Macher der sozial-ökologischen Transformation werden.
impact: Die sozial-ökologische Transformation ist das große Schlagwort unserer Zeit. Warum glauben in Deutschland viele, Ökonomie und Ökologie seien nicht miteinander vereinbar?
Klüh: Das ist eine sehr gute Frage. Viele ahnen wohl im Prinzip, dass eine ausreichend schnelle ökologische Transformation der Wirtschaft nur mit einem erheblichen Maß staatlicher Einflussnahme gelingen kann – immerhin müssen wir in den nächsten zehn bis 15 Jahren radikale Veränderungen herbeiführen, die oft nicht im Interesse eines gewinnorientierten Investors sind. In Deutschland sitzt aber die Angst vor einer zu großen Macht staatlicher Akteure tief. Das liegt einerseits in der Natur des rheinischen Kapitalismus; andererseits sind das Lehren, die man aus der Zeit des Nationalsozialismus zieht. Und tatsächlich ist ein starker Staat ja auch eine zwiespältige Sache, er steht gleichermaßen für unser wunderbares Gemeinwesen und für die ständige Gefahr des Machtmissbrauchs. In Deutschland sind solche Vorstellungen insbesondere durch den Ordoliberalismus sehr wirkmächtig. Dabei handelt es sich um eine eher statische, auf Ordnung bedachte Vorstellung des Verhältnisses von Politik und Wirtschaft. Transformation bedeutet im Gegensatz dazu radikale, systemübergreifende Veränderung, es ist ein von Akteuren angetriebener, zeitlich dramatisierter Prozess. Und das passt nicht zur „deutschen“ Denkweise von Wirtschaft, Politik und gesellschaftlichem Fortschritt.
impact: Bedeutet Transformation auch, dass wir uns vom Paradigma des Wachstums verabschieden müssen?
Klüh: Vom Paradigma vielleicht, aber nicht vom Wachstum selbst. Ich halte es für äußerst kontraproduktiv, die Frage nach der sozial-ökonomischen Transformation immer nur im Spannungsfeld von Wachstum und Post-Wachstum zu diskutieren. Gelungene Transformation kann mit ganz unterschiedlichen Wachstumsraten einhergehen, je nachdem wie ich Wachstum messe und in welcher Phase der Transformation ich mich befinde. Wir sollten nicht erschrecken, wenn Fortschritte im Hinblick auf Nachhaltigkeit machen und dabei Wachstum entsteht. Das ist fast unvermeidlich, weil viele Dinge, die wir tun müssen, in einer Übergangsphase erst einmal Wachstum erzeugen werden. Das gilt für die notwendige Umverteilung von Vermögen und Einkommen, für die sehr hohen öffentlichen Investitionen, die zu tätigen sind, und auch für den technischen Fortschritt, ohne den es nicht gehen wird.
impact: Sie sind offensichtlich kein Freund der Idee, dass wir Negativwachstum brauchen?
Klüh: Die erste Frage, die ich in diesem Zusammenhang stellen würde, wäre: Wer ist „wir“? Die Weltgesellschaft braucht mit Sicherheit noch etwas Wachstum, denn es gibt noch viele, die im Elend leben. Die Postwachstumsbewegung beteuert zwar, man berücksichtige das, indem man durch Negativwachstum im globalen Norden Wachstum im globalen Süden ermögliche. Aber für ein solches politisches Programm des differenzierten Wachstums passt der Begriffe „Postwachstum“ eben nicht besonders gut. Man verharrt aus meiner Sicht letztlich bei einer Zentrierung auf die Perspektiven des globalen Nordens und dort wiederum auf die Bevölkerungsschichten, die sich Postwachstum leisten können. Das politische Programm für eine nachhaltige Welt braucht aber ein Leitbild, das für Nord und Süd, für Arm und Reich, anschlussfähig ist und politische Leidenschaften wecken kann.
impact: Wachstum kann ja Verschiedenes bedeuten, es gibt Wachstum ohne Ressourcenverbrauch. Wäre das ein denkbarer Weg?
Klüh: Es müsste sogar Wachstum mit negativem Ressourcenverbrauch sein, und ob wir das schaffen können, ist die zweite entscheidende Frage. Dabei denken viele zuerst an ein Wachstum nach bisherigem Muster. Neue, „grüne“ Technologien und Produktionsformen ersetzen die alten. Die meisten Untersuchungen sind recht skeptisch, ob dieses „Green Growth“ gelingen kann. Entsprechende Vorstellungen sind allenfalls Teil einer tragfähigen Lösung. Ausreichen werden sie aber nicht, denn sie stellen sich Wachstum als das vor, was es bisher war, ein Modernisierungsprozess. Wenn wir aber Transformation wollen, wird es ganz neue Formen des Wachstums gaben. Dann wäre Wachstum mit negativem Ressourcenverbrauch vielleicht möglich.
impact: Ein Beispiel…?
Klüh: Ein Beispiel ist die sogenannte Sorgearbeit. Wenn ich für Besuche bei meiner pflegebedürftigen Mutter ab morgen ein saftiges Gehalt bekäme, würde die Wirtschaft wachsen und der Ressourcenverbrauch sinken. Bisherige Besuche würden ins Bruttoinlandsprodukt eingehen – ressourcenneutrales Wachstum. Zudem würde ich weniger mit dem Auto nach Darmstadt fahren oder umweltschädliche digitale Technologien nutzen, sondern die zehn Minuten übers Feld zur Pflegeeinrichtung laufen – ressourcensparendes Wachstum. Befürworter von Postwachstum sagen dann gerne, dass das doch Buchhaltungstricks seien. Natürlich ist das „Buchhaltung“, aber Wirtschaft ist eben zu einem nicht unbeträchtlichen Ausmaß Buchhaltung. Die Frage ist: Wollen wir das? Wollen wir den Markt und die monetäre Bewertung solcher Tätigkeiten so weit treiben oder nicht?
impact: Was spricht dagegen?
Klüh: Das Leben sollte vielleicht mehr sein als Wirtschaft? Eine Gesellschaft entwickelt, wenn zu viele Dinge als Ware betrachtet werden, eine Art natürliche „Immunreaktion“, ganz ähnlich wie die Reaktion unseres Körpers auf Covid… Wenn wir den Boden und die Natur zu sehr zur Ware machen, unterwerfen wir sie der Logik einer kapitalistischen Verwertung, und darin steckt ein zerstörerisches Potenzial. Wenn wir die menschliche Tatkraft zu sehr zur Ware machen, gerät der Mensch mit seinem Bedürfnis, sich in der Gemeinschaft selbst zu verwirklichen, an seine Grenzen. Der hierdurch verursachte Widerwille setzt der Möglichkeit, alles zu monetisieren, eine Grenze, was nicht heißt, dass es unbedingt falsch ist, Dinge zu monetisieren – Stichwort Sorgearbeit. Das Unbehagen mit der Globalisierung und deren Grenzen sind übrigens gut als eine solche „Immunreaktion“ zu beschreiben.
impact: Eine „Immunreaktion“ also gegen die Entgrenzung der Märkte auf kleiner wie globaler Ebene. Manchmal schießt das Immunsystem aber auch übers Ziel hinaus, bei einer Allergie etwa...
Klüh: Ja, diese Gegenreaktion kann auf gesunde oder schädliche Weise ablaufen. Im guten Fall entwickeln sich gesellschaftliche und häufig eben auch staatliche Institutionen weiter, es gelingt, den Markt in Schach zu halten und allen geht es ein bisschen besser. Es kann aber auch – und das haben wir in den 1930er Jahren in Deutschland und einigen anderen Ländern erlebt – zu verheerenden Versuchen der „Wiedereinbettung von Märkten“ kommen. Das beobachten wir auch heute: Trump, Brexit, die AfD, das Aufkommen der ganzen rechtsnationalen Kräfte…
impact: Was wären konstruktive Alternativen?
Klüh: In den 1930er Jahren gab es in den Vereinigten Staaten die Überzeugung, dass man die Gesellschaft grundlegend auf den Kopf stellen müsse, um faschistischen Tendenzen entgegenzuwirken. Präsident Franklin D. Roosevelt nannte das den „New Deal“ – grundlegende Wirtschafts- und Sozialreformen, ein neues Verhältnis zwischen Staat und Markt, zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, zwischen Finanzmärkten und Realwirtschaft, weniger Wettbewerb. Ein neues Makroregime, wie ich das nenne. So gelang die Wiedereinbettung der Märkte auf eine vernünftige Art und Weise. Und ich glaube, an diesem Punkt sind wir im Moment auch.
impact: Die EU beschreitet jetzt den Weg des sogenannten „Green Deal“.
Klüh: Dummerweise. Die EU hat die Hälfte des Konzepts verstanden, weil sie es „Deal“ nennt. Sie hat auch verstanden, dass ein „Deal“ heute an den planetarischen Grenzen ansetzen muss. Sie lässt aber ganz bewusst das „New“ weg, weil dies auch eine soziale Transformation andeuten würde, eine Verschiebung von Machtverhältnissen. Man bekommt sogar den Eindruck, dass man mit dem eher modernistischen Green Deal versucht, einen transformativen, sozial-ökologischen „Green New Deal“ abzuwehren. Die EU hat eben auch ihren genetischen Code, und der ist stark von einer Präferenz für Freihandel und Marktlogik geprägt. Eine gewisse Zuversicht darf man aber auch haben. Erstens gibt es mit dem Green Deal nun einen Plan, über den sich trefflich streiten lässt, und Transformation bedeutet nicht zuletzt die Austragung politischer Konflikte. Zweitens bekommt der Green Deal durch Corona eine unerwartet große Dynamik. Bisher war er einfach nicht durchfinanziert, nun werden im Rahmen der Corona-Hilfsprogramme substanziell Mittel bereitgestellt. Und drittens kommt es zu der schon angesprochenen Deglobalisierung. Der Green Deal muss sich dazu positionieren,.
impact: Japan versucht infolge der Corona-Pandemie, Produktionsstandorte aus China zurück zu verlagern. Müsste die EU das auch tun – zum Beispiel in kritischen Bereichen wie der Medizintechnik oder der Pharmaindustrie?
Klüh: Ich kann das mit einem klaren Ja beantworten. Ich glaube, das passiert ohnehin, man muss nur das Wirtschaftsressort der Zeitungen aufschlagen. Es wird in der Bevölkerung nicht mehr die Bereitschaft geben zu akzeptieren, dass wir hier im Zweifelsfall kein Antibiotikum mehr selbst produzieren können. Ebenso zeigt die aktuelle Diskussion um ein Lieferkettengesetz, dass echte Kontrolle über Menschenrechte es erforderlich macht, die Komplexität von Wertschöpfungsketten zu reduzieren. Wenn wir dann noch fragen, ob so etwas wie eine echte klima- und umweltpolitisch notwendige Kreislaufwirtschaft nicht besser mit regionaleren Wertschöpfungsketten machbar wäre, wird schnell klar, wie akut das Thema Deglobalisierung ist.
impact: Gleichzeitig darf Deglobalisierung aber nicht bedeuten, den armen Ländern dieser Welt Entwicklungschancen zu verbauen, oder?
Klüh: Ich würde den Begriff „achtsame Globalisierung“, den EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ins Spiel gebracht hat, deshalb in „achtsame Deglobalisierung“ überführen. Globale Probleme benötigen globale Antworten, globale Kooperation und auch internationalen Handel, aber nicht Freihandel um des Freihandels willen. Ein Beispiel ist die Wasserstoffstrategie, zu der mir gerade eine Masterarbeit auf den Tisch geflattert ist. Dazu gehört die Idee, dass wir Regionen wie Westafrika zu einem neuen Ort der Energieproduktion machen und den Ländern dort eine Möglichkeit geben, sich technisch zu entwickeln. Gleichzeitig würde das unsere Klimabilanz erheblich verbessern und dabei auf bestehende Gasnetze und ein ressourcenschonendes Recycling bestehender Technologien bauen können. Da steckt eine Menge Potenzial drin, wenn man es ernst meint mit der sozial-ökologischen Transformation. Das bedeutet aber auch, wie schon formuliert, dass der Staat Vorgaben machen muss, wo es langgeht. Einfach mal die Energieproduktion von der arabischen Halbinsel nach Westafrika zu verlegen, das regelt nicht der Markt allein…
impact: Die staatliche Steuerung ist das eine, das andere ist die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger. Vieles wird durch ökologisches Umsteuern teurer. Es müssten also alle in der Lage und obendrein auch noch gewillt sein, für einige Produkte und Dienstleistungen mehr zu bezahlen.
Klüh: Absolut richtig, zumal im notwendigen Strukturwandel viele Jobs auch wegfallen. Eine sozial-ökologische Transformation verlangt deshalb ein sehr hohes Maß an Umverteilung. Ich halte deshalb eine stärkere Besteuerung von Vermögen für einen ganz integralen Bestandteil jeder sozial-ökologischen Transformation, und zwar aus gleich mehreren Gründen. Vermögenssteuern würden nicht nur helfen, die notwendigen öffentlichen Investitionen zu finanzieren und die Transformation verteilungspolitisch zu flankieren. Neue Forschung zeigt, dass sie auch Strukturwandel und Innovation fördern kann, weil eine Fehlnutzung von Vermögen bestraft wird. Dazu kommen ökologische Lenkungswirkungen. Bei der Grundsteuer ist das ja offensichtlich, dass die Art der Landnutzung damit beeinflusst werden kann. Aber man kann auch über Steuern für spezifische Vermögensgegenstände nachdenken, wie Pools, Privatflugzeuge oder Yachten. Das würde natürlich Widerstände erzeugen, aber für eine breite Akzeptanz wäre das allemal besser, als erst einmal den Jahresurlaub auf den Kanaren unbezahlbar zu machen.
impact: In den USA würde man Sie als Sozialisten abstempeln.
Klüh: Das ist richtig.
impact: Hierzulande teilweise auch.
Klüh: Ich würde da zunächst einmal antworten, dass in den USA viele demokratische Präsidentschaftskandidaten und –kandidatinnen auf hohe Vermögenssteuern in Verbindung mit einen Green New Deal gesetzt haben. Und weder Bernie Sanders noch Elizabeth Warren wollten den Markt ganz abschaffen. Dazu kommt: Niemand kann sich sicher sein, dass wir die ökologischen und sozialen Herausforderungen im Kapitalismus stemmen können. Wir haben aber wohl keine andere Wahl, als es mit dem Kapitalismus zu versuchen. Das Zeitfenster, das wir insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel haben, ist so klein, dass ein Systemwechsel vorher gar nicht mehr möglich ist. Wir haben nur die Chance, das System so radikal umzubauen, dass es irgendwie funktioniert. Was danach kommt, wird man sehen müssen. Ich bin als Ökonom neutral, was Wirtschaftssysteme angeht.
impact: Wirklich?
Klüh: Ja.
impact: Das ist überraschend, das sind vermutlich nur Wenige in Ihrem Fachgebiet.
Klüh: Das stimmt. In den Wirtschaftswissenschaften gibt es eine starke Tendenz, einen „Bias“ zu Marktmechanismen. Es gibt diese Vorstellung von Wirtschaftswissenschaft als Marktwissenschaft. Aber es kann deshalb nicht meine Aufgabe sein, Marktmechanismen grundsätzlich schlechtzureden oder grundsätzlich zu verteidigen. Meine Aufgabe ist es, darauf hinzuweisen, dass wir uns hüten sollten, diesen Bias, der in unsere Wissenschaft eingewoben ist, nicht zu reflektieren.
impact: Dann nennen wir es also nicht Systemwechsel, sondern „achtsame Deglobalisierung“. Wie kann sie gelingen?
Klüh: Eine erste Idee habe ich oben schon anhand der Wasserstoffstrategie genannt. Etwas allgemeiner geht es da um neue Formen der globalen Arbeitsteilung. Ebenso wichtig wird es sein, über neue, den Nationalstaat überwindende Formen der Staatlichkeit nachzudenken. Die europäische Integration hat hier eine ganz überragende Bedeutung, ebenso wie eine Ertüchtigung der internationalen Organisationen. Man wird auf Dauer auch Organisationen wie meinen alten Arbeitgeber brauchen, den Internationalen Währungsfonds. Seine Aufgabe und Rolle wird sich aber radikal ändern müssen.
impact: Wie denn?
Klüh: Einer der größten Fehler bei der Aufarbeitung der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007 war, dass man die damalige Forderung nach einem neuen „Bretton Woods“, einer neuen globalen Wirtschaftsordnung wie nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht aufgegriffen hat. Als wenn das nicht alles schon kompliziert genug wäre, muss aber noch etwas viel Schwierigeres passieren: Wir müssen ganz neue Vorstellungen davon entwickeln, wie unterschiedliche Ökosysteme und Communities auf einem fragilen, teils schon zerstörten Globus zusammenhängen. Und dazu gehört es, eine neue Vorstellung von internationalen Beziehungen zu entwickeln, die über die Beziehung zwischen Regierungen hinausgeht. Eine wichtige Frage ist beispielsweise, wie globale Vernetzung zwischen lokalen Communities in Zukunft aussehen kann? Das geht weit über den früher beliebten Spruch „Global denken, lokal handeln“ hinaus. Eines der besten Bücher, die in den letzten fünf Jahren dazu geschrieben wurden, ist das Buch „Der Pilz am Ende der Welt“ von Anna Lowenhaupt Tsing.
impact: Was hat es mit diesem Pilz auf sich?
Klüh: Es ist ein Pilz, für den japanische Restaurants Unsummen zahlen. Und dieser Pilz wächst besonders gut an Orten, die ökologisch degeneriert sind oder die sogar eine ökologische Katastrophe durchgemacht haben. Für diesen Pilz gibt es einen globalen Markt, der über komplexe Wertschöpfungsketten gesteuert wird. Es gibt in den USA Leute, die in zerstörten Wäldern diese Pilze sammeln. Die Pilze werden auf Märkte gebracht. In San Francisco warten Exporteure, die die Pilze nach Japan bringen. Es gibt also einen globalen Austausch zwischen unerwarteten Akteuren, neue lokale Zusammenschlüsse und eine neue Form der Globalisierung, die da ansetzt wo wir uns immer mehr befinden: in einer äußerst prekären Lage.
impact: Da lacht der millionenschwere DAX-Manager nur milde, oder?
Klüh: Ich habe auch lange die Fair-Trade- und die Eine-Welt-Bewegung belächelt, obwohl das eigentlich meine Sozialisation ist. Inzwischen denke ich anders darüber. In der achtsamen Deglobalisierung müssen wir ja Antworten auf die Frage finden, wo internationale Arbeitsteilung unerlässlich ist und wo sie besonders stark zu einer nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft beiträgt. Wenn ein Alpakka-Pulli oder eine Decke aus Bolivien viele Jahrzehnte hält und ihre Produktion verletzlichen lokalen Communities ein sicheres Auskommen bietet, dann ist deren Export „achtsame Globalisierung“. Die braucht man, um auch die achtsame Deglobalisierung hinzubekommen. Doch zurück zum lächelnden Manager. Auch dessen Lage wird auf einem sich stark erwärmenden Planeten ja immer prekärer. Und genau da setzt das Buch von Tsing an: Die Pilze im Buch stehen wie die beschrieben Menschen für erfolgreiche Überlebensstrategien in den Ruinen des Kapitalismus, der uns allesamt in eine Art Prekariat befördert hat. Doch genau daraus lässt sich Hoffnung schöpfen, weil die liberale Fiktion zerlegt wird, es komme auf den Einzelnen an, der seines Glückes Schmied ist. Weil wir prekär sind, kollaborieren wir, lokal und global. Genau wie der Pilz in der Mitte des Störfalls gedeiht und mit allem zusammenhängt, haben wir in der Mitte des Corona-Störfalls auch Momente des Gedeihens erlebt: Wir haben gespürt, dass die Fiktion einer Gesellschaft, die aus starken Einzelnen besteht, sehr brüchig geworden ist. Und vielleicht liegt darin dann doch ein gewisser positiver Effekt.
Weiterführende Links:
Website von Prof. Dr. Ulrich Klüh: Lehrende am Fachbereich Wirtschaft
Zentrum für Nachhaltige Wirtschafts- und Unternehmenspolitik: https://znwu.de
Showdown Papers, 3.4.2020: The pitiless crowbar of events
Karl Polanyi: The Great Transformation
Bruno Latour: Das terrestrische Manifest
Anna Lowenhaupt Tsing: Der Pilz am Ende der Welt
Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit, 1972: Die Grenzen des Wachstums
Kontakt
Christina Janssen
Wissenschsftafsredakteurin
Hochschulkommunikation
Tel.: +49.6151.16-30112
E-Mail: christina.janssen@h-da.de