Martin Führ: „Recht fördert Innovation“

Öffentliches Recht, Rechtstheorie und Rechtsvergleichung – sexy klingt anders. Trockene, realitätsferne Materie? Denkste! Professor Dr. Martin Führ lehrt Verwaltungsrecht, arbeitet aber nah am Menschen. Er befasst sich mit dem Schutz von Arbeitern in der Textilindustrie, von Radfahrern im Stadtverkehr oder der innerstädtischen Luftqualität. Als Sachverständiger und Experte ist Führ bundesweit gefragt. In Sachen Nachhaltigkeit an der h_da laufen viele Fäden bei dem Sechzigjährigen zusammen.
Herr Führ, Sie machen sich mit Ihrer Arbeit in manchen Kreisen ziemlich unbeliebt. Haben Sie im Dunkeln manchmal Angst, allein auf die Straße zu gehen?
Prof. Dr. Martin Führ: Nein, ich hatte das nie – aber meine Frau kurzzeitig. 1994 hatte ich auf einer Tagung der chemischen Industrie in einem Redebeitrag deutliche Kritik an der Haltung der Topmanager der Branche geübt. Daraufhin gab es im Saal eine regelrechte Pogromstimmung gegen mich. Meine Frau, die im Auditorium saß, hat diese Stimmung derart schockiert, dass sie in den Wochen danach befürchtet hat, man könne mir etwas antun. Aber die chemische Industrie hat sich deutlich gewandelt, da gab es eine steile Lernkurve. Solche Anfeindungen würde es heute nicht mehr geben.
Sie sind weder Arzt noch Maschinenbauer oder Chemiker. Wie tief müssen Sie in fremde Materien eintauchen, um praxisnahe und wasserdichte juristische Statements auf diesen Feldern abgeben zu können?
Wasserdichte juristische Statements gibt es nicht. Man kann die Dinge fast immer auch anders sehen. Es braucht gute Argumente. Und die sind umso besser, je tiefer man in ein Thema eindringt. Nur wenn man den Kern des Problems erfasst hat, kann man eine maßgeschneiderte Antwort des Rechts finden. Geht es etwa um die Stickoxidgrenzwerte in der Umgebungsluft, muss man verstehen, wie Toxikologen arbeiten und auf welche Konventionen sie sich bei ihren Empfehlungen stützen. Kein Grenzwert ist hundertprozentig naturwissenschaftlich fundiert. Wer das suggeriert, führt die Öffentlichkeit in die Irre. Es gibt immer eine Abwägung und am Ende meist eine politische Entscheidung – in Gestalt des Rechts. Dabei fließen technische, toxikologische oder ökonomische Aspekte mit ein.
Ihre Rolle ist es, rechtliche Sachverhalte nüchtern zu bewerten. Dennoch nimmt man Sie wahr als jemand, der sich für saubere Luft und sicheres Radfahren einsetzt. Wie kommt das?
Ein juristisches Gutachten muss aus sich heraus überzeugen und sein Ergebnis nach den Spielregeln der juristischen Argumentationskunst herleiten. Etwas anderes ist es, dieses Ergebnis dann zu vermitteln. Dazu muss man die Dinge klar auf den Punkt bringen. Sonst geht der Inhalt verloren. Gutachten werden ja nicht nur von Juristen gelesen. Was das angeht, bin ich wohl durch die zehn Jahre beim Öko-Institut geprägt. Dort mussten wir nicht nur die inhaltliche Arbeit, sondern auch die Öffentlichkeitsarbeit machen. Man muss Geschichten erzählen und Dinge prägnant zuspitzen. Im Dieselskandal habe ich 2016 davon gesprochen, dass sich eine ‚Kultur der Missachtung des Rechts‘ eingebürgert hat. Damit wollte ich auf den Punkt bringen, dass die Automobilindustrie es nicht für nötig hielt, die Vorschriften einzuhalten und die Aufsichtsbehörden auch nicht draufgeschaut haben. Diese Formulierung fand sich dann vielfach in der medialen Berichterstattung wieder.
Wie motivieren Sie sich für die Aufgaben, die Sie über Ihre eigentliche Arbeit hinaus übernehmen?
Man braucht intrinsische Motivation und eine entsprechende Überzeugung. Ein Gutachten für den Bundestag zu schreiben, bedeutet erhebliche Zusatzarbeit. Das muss einem auch Spaß machen. So fürstlich honoriert ist das nicht. (lacht)
Aber bei vielen Themen, mit denen ich mich auseinandersetze, ist meine Überzeugung in weiten Teilen deckungsgleich mit der normativen Orientierung des Grundgesetzes. Artikel 20a des Grundgesetzes sagt: ‚Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere‘. Insofern versuche ich, Regeln, auf die die Gesellschaft sich bereits verständigt hat, mit Leben zu füllen. Jeder hat irgendwelche Talente und ist aufgefordert, diese auch zum Allgemeinwohl einzusetzen und der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Ich bin nun mal Hochschullehrer und Jurist, also versuche ich das aus dieser Position heraus. Die jungen Leute bei den „Fridays for Future“-Demonstrationen ermahnen uns, jetzt zu handeln. Das ist nichts anderes als der Leitspruch des Öko-Instituts: ‚Wir können nur hoffen, wenn wir selbst handeln.‘
Auch an der h_da sind Nachhaltigkeitsthemen sehr präsent...
… und das ist gut so! Nachhaltigkeit ist die Gretchenfrage unserer Generation. Wobei wir bewusst nicht von Nachhaltigkeit sprechen, sondern von Nachhaltiger Entwicklung, weil da schon der Veränderungsimpuls mit drinsteckt. Angesichts der Größe der Herausforderung ist es nur recht und billig, dass wir als Hochschule für angewandte Wissenschaften mit starken technischen Schwerpunkten uns dessen annehmen, um einen Beitrag zu leisten. Aber alleine mit technischer Innovation werden wir den Planeten nicht retten. Lösungen brauchen immer soziale Interaktion und gesellschaftliche Prozesse. Dieses Zusammenspiel zeigt sich an der h_da nicht zuletzt im Forschungszentrum. Die h_da hat viele sinnvolle Richtungsentscheidungen für Nachhaltige Entwicklung getroffen. Erst Ende April hat das Präsidium beschlossen, Nachhaltige Entwicklung als Thema und Aufgabe an der h_da zu verankern. Das ist eine programmatische Aussage, über die wir uns sehr freuen.
Das Begleitstudium Sozial- und Kulturwissenschaften, kurz SuK, gibt es seit der Gründung der damaligen Fachhochschule. War das eine frühe Weichenstellung für das heutige Profil?
Der Gründungsrat der Fachhochschule hat das 1971 aus freien Stücken entschieden. Dank SuK belegen Studierende der ingenieur- und naturwissenschaftlichen sowie der gestalterischen Studiengänge vom ersten Semester an auch sozial- und kulturwissenschaftliche Fächer. Das bringt permanent andere Perspektiven hinein. So konnten sich Netzwerkstrukturen zwischen allen Fachbereichen aufbauen, die bis heute tragen und von denen die gesamte h_da profitiert. Das hat auch den Weg für Studiengänge wie Energiewirtschaft oder Onlinejournalismus bereitet.
… oder für den Masterstudiengang RASUM, Risk Assessment and Sustainability Management?
Dabei spielte nicht zuletzt sofia eine Rolle, die Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse. Hier ist drittmittelfinanziert ein interdisziplinäres Team entstanden, das Probleme aus unterschiedlichen Perspektiven durchleuchtet und Lösungen findet. Dort sind hohe fachliche Expertise und hohe Methodenkompetenz vereint – einschließlich der Fähigkeit, die Inhalte Außenstehenden plausibel zu erläutern. Dieses Know-how ist in das Studiengangskonzept von RASUM geflossen: Risiko-Abschätzung und Nachhaltigkeitsmanagement. Dabei geht es um eine ganzheitliche Sichtweise vor betriebswirtschaftlichem, organisationalem und technisch-naturwissenschaftlichem Hintergrund. Bei den Praxisprojekten geht es beispielsweise um Chemikalien in Outdoorbekleidung oder umweltfreundliche Lieferketten. RASUM ist letztlich das SuK-Modell auf Masterebene.
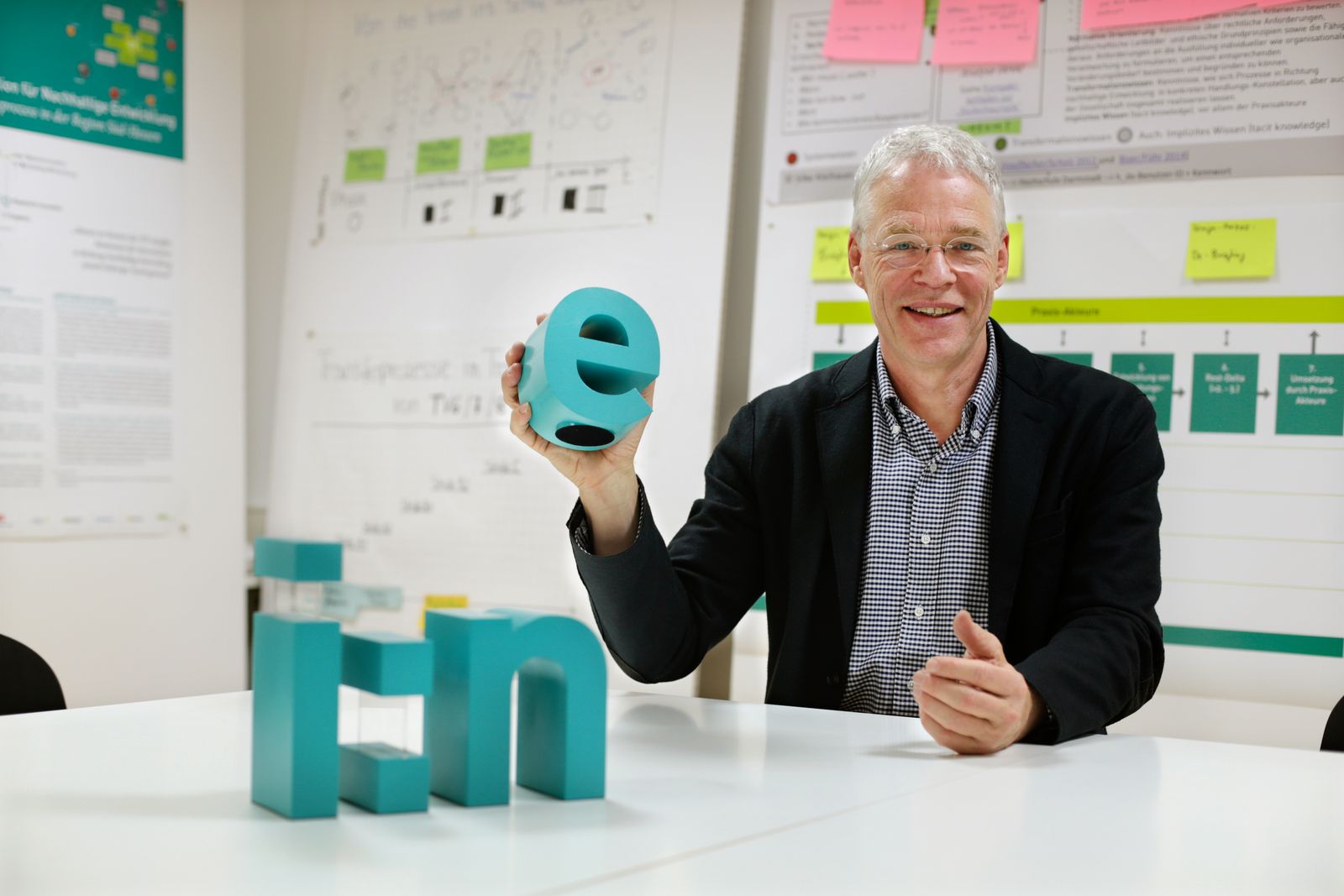
Sie haben SuK, sofia und RASUM erwähnt. Mindestens zwei weitere Nachhaltigkeits-Initiativen begegnen einem an der h_da häufig: i:ne und s:ne. Worum geht es da?
In der Initiative für Nachhaltige Entwicklung, i:ne, können sowohl Studierende als auch Lehrende und Mitarbeiter gemeinsam dazu beitragen, das Wirken der Hochschule Richtung Nachhaltige Entwicklung auszurichten. Sie ist ihrer Art nach bundesweit einmalig. Mit s:ne – Systeminnovation für Nachhaltige Entwicklung – haben wir eine Architektur geschaffen, die ein lernendes System etablieren soll. Das ist als Exzellenzprojekt Teil des Bund-Länder-Programms Innovative Hochschule. Wir haben das Thema Nachhaltige Entwicklung an der h_da von unten nach oben aufgebaut. Ich finde dafür das Bild der Seerosen passend. Die gibt es erst vereinzelt an verschiedenen Stellen auf dem Teich, dann wird es immer mehr. Oft ist der Wurzelstock schon ausgebildet, ehe an der Oberfläche etwas sichtbar wird. Aber irgendwann ist es von oben als geschlossene Decke zu erkennen. Obwohl es unter den derzeitigen Rahmenbedingungen schwierig ist, gelingt es uns immer wieder, Förderungen zu bekommen. Das ist kein Zufall. Was angewandte Forschung und Transfer angeht, sind wir an der h_da auf Exzellenz-Niveau. Wir sind hier wirklich gut aufgestellt – und könnten noch deutlich besser werden.
Im März hat das Land Hessen der h_da das bundesweit einmalige Promotionsrecht in Nachhaltigkeitswissenschaften verliehen. Das erste eigenständig von der h_da betriebene Promotionszentrum, an dem man den Dr. rer. sust. erwerben kann. Ein weiterer Meilenstein?
Das kann ein echter Meilenstein sein – wenn es uns gelingt, den damit verknüpften Anspruch einzulösen. Die bestehenden Initiativen, SuK, RASUM, das Forschungszentrum und nun das Promotionszentrum: Das ergibt ein ganz starkes Profil für die h_da! Aber eine Promotionsbetreuung braucht Qualität, also Ressourcen. Das bedeutet viel weitere Arbeit, das ist herausfordernd. Promotion heißt ja immer Neuland; als Betreuer kennt man sich auf dem Gebiet selbst nur bedingt aus. Und für die Promovenden ist es wie Kajakfahren im Eiswasser: Da besteht immer die Gefahr, sich in eine Sackgasse zu manövrieren. Interdisziplinäre Promotionen in Nachhaltigkeitswissenschaften zu betreuen, ist für alle Beteiligten neu. Wir stehen da vor einem kollektiven Lernprozess.

Stichwort Lernen. Was sollte Lehre aus Ihrer Sicht leisten?
Wir sollten unsere Studierenden fachlich und methodisch für die anstehenden Veränderungen in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik ausbilden. Lehren wir nur durch die juristische Brille und denken wir nur vom Wortlaut des Rechts her, ist das eine Schwäche. Das Vorurteil vom Juristen als Paragrafenreiter gibt es ja nicht ganz zufällig. Erst wenn man vom Problem her denkt, kann man bessere und überzeugendere Lösungen entwickeln. In meinen Lehrveranstaltungen versuche ich so oft wie möglich, gemeinsam mit den Studierenden nach konkreten Antworten zu suchen. Das ist viel fruchtbarer und bringt bessere Ergebnisse als eine stur an den Gesetzestexten ausgerichtete Lehre. Das Recht ist meistens nichts anderes, als in Paragrafen und Artikel gefasster gesunder Menschenverstand – englisch: Common Sense. Wenn man das Zusammenspiel von Problem und Antwort der Gesellschaft versteht, begreift man viel leichter die innere Struktur des Rechts.
Mit welchen Mitteln lässt sich das erreichen?
Man muss das Setting so wählen, dass es die Studierenden motiviert und nach vorne bringt. Ein starker Anreiz ist es, wenn sie ein reales Gegenüber haben. Das kann der Darmstädter Oberbürgermeister sein, wie jährlich zum Abschluss der i:ne-Ringvorlesung, oder die Geschäftsführerin eines Unternehmens wie bei den RASUM-Praxisprojekten. Bei einem Projekt mussten die Studierenden ihre Angebote und später die Ergebnisse in Videokonferenzen mit der Unternehmenszentrale in Detroit präsentieren. Das motiviert mehr als der beste Englischkurs. Das war dann fachlich, methodisch und sprachlich erste Sahne! Ich habe die meisten meiner Foliensätze eingemottet und arbeite am liebsten mit den Studierenden an der Tafel. Da sind sie viel wacher dabei, weil sie selbst das Ergebnis mitgestalten; und es bleibt mehr hängen. Oder ich sage ihnen: ‚So, ihr seid jetzt gewählte Bundestagsabgeordnete der Fraktionen X, Y und Z.‘ Dieser Rollen- und Perspektivwechsel, das aktive Formulieren von Lösungsansätzen, das bringt viel mehr als passives Rezipieren. So macht Lehre den Studierenden und einem selbst mehr Spaß.
Ihre Habilitationsschrift trägt den Titel „Eigen-Verantwortung im Rechtsstaat“. Ein unvermindert aktuelles Thema?
Ja, zumal, wenn wir die Herausforderungen betrachten, die wir als Gesellschaft zu bewältigen haben: etwa Klimaschutz oder Chemikalienregulierung. Da ist allein der klassische Ansatz, die Probleme mit Verboten und Sanktionen zu lösen, nicht zielführend. Denn der Staat versteht zwar vielleicht, worin das Problem besteht – aber er kann die Lösung nicht erzwingen. Er ist auf Mitwirkungsbereitschaft, Veränderungswilligkeit und Kreativität der problemverursachenden Akteure angewiesen. Der Staat kann nicht 130.000 Chemikalien testen und regulieren. Was die Branche braucht, um die herauspicken, die den größten Nutzen für die Menschheit stiften und dabei den geringsten Schaden anrichten – Verfahren, Prozesse, Methoden –, kann der Staat nur unterstützend ermöglichen. Was ich hier mit ‚Eigen-Verantwortung‘ meine, ist eine Verantwortung, die zwar an die Eigeninteressen anknüpft, aber auch die Interessen des Gegenüber berücksichtigt, also zum Beispiel der Gesellschaft und kommender Generationen. Der Staat muss Rahmenbedingungen schaffen, die die Industrie anhalten, ihre Innovationspotenziale in diese Richtung zu entfalten und deren Verhalten entsprechend lenken. Dazu muss er zuerst verstehen, was die Akteure antreibt.

Plastikmüll, Lebensmittelampel, Tierwohl-Label – die Politik setzt bei vielen in Bevölkerung und Industrie umstrittenen Themen auf freiwillige Selbstverpflichtungen. Können die etwas bewirken?
Freiwillige Selbstverpflichtungen funktionieren nur ganz selten. Wenn man vermeiden will, dass Akteure eine nicht reglementierte Situation zu ihrem Vorteil ausnutzen, braucht man klare Spielregeln. Das proaktiv im Sinne von Umwelt- und Gesundheitsschutz handelnde Unternehmen braucht die Hilfestellung des Staates. Regularien können den Anreiz bilden, Produkte zu verbessern. Sonst ist es in den meisten Fällen einfacher, die schlechteren, aber billigeren Lösungen unters Volk zu bringen. Innovation und Regulierung schließen sich nicht aus. Im Gegenteil: Recht ist oft ein Faktor, der Innovation fördert!
Wir erleben gerade, wie widerwillig die Bevölkerungsmehrheit von Verbrennungsmotoren und dem Besitz von Autos abrückt. Wie ließe sich die Mobilitätswende in Gang bringen?
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das zeigt sich gerade beim Thema Verkehr. Da müssen starke Impulse und Signale von außen kommen, um das anzustoßen. Das Grundproblem ist: Die meisten Wähler sind auch Autofahrer. Und diese mächtige Gruppe will kein Politiker vergraulen. Beharrungsvermögen und mangelnde Fantasie bringen die Menschen dazu, in Veränderungen eher den möglichen Verlust zu sehen. Man müsste stattdessen das Positive, den ‚Benefit‘ in den Vordergrund stellen. Die Überschrift müsste lauten: ‚Lebensqualität in den Städten erhöhen!‘ Ein Beispiel: Wenn die Gasleitung vor Ihrem Haus erneuert wird und die Straße für Wochen gesperrt ist, kann das der Impuls sein, der Ihre Gewohnheiten ändert. Damit ergibt sich ein zeitlich-regulatorischer Experimentierraum, in dem Sie nicht mehr mit dem Auto bis vor die Haustür fahren können. Dann stellt sich womöglich ein Lernerfolg ein: ‚Huch, ich kann ja auch zu Fuß gehen und bin genauso schnell am Ziel – und mit dem Rad vermutlich sogar schneller!‘
Müssen solche Veränderungen immer erst die Widerstände menschlicher Trägheit oder mächtiger Lobbygruppen überwinden? Oder gibt es auch ein Miteinander mit Unternehmen, die Verhältnisse aus eigenem Antrieb verbessern wollen?
Auch das gibt es. Zum Beispiel bei der Proactive Alliance. Darin arbeiten wir mit führenden Global Playern aus verschiedensten Branchen zusammen: Automobil, Elektronik, Chemie, Möbel, Textilien, Sportartikel, Medizinprodukte. Wir nehmen dort mit sofia die Rolle des ‚ehrlichen Maklers‘ ein und koordinieren die Aktivitäten. Die Industrie arbeitet dort an einem Standard für eine einheitliche, vollständige Inhaltsdeklaration von Produkten, egal, um welche Branchen es geht: Full Material Declaration. Damit wüsste der Händler, aber auch der Kunde jederzeit genau, welche Stoffe in einem Produkt enthalten sind. Die Unternehmen haben die Notwendigkeit dafür erkannt. Ihnen geht es außerdem um Qualitätssicherung und Compliance, also die Einhaltung von Rechtsnormen. Schaffen wir das, wäre das auch eine enorme Erleichterung für die Industrie. Wir wollen das im Herbst 2020 auf der UN-Konferenz zum ‚Strategic Approach on Chemicals Management‘ präsentieren. Aktuell muss ich eher fürchten, statt der Todesdrohung demnächst einen Preis von der chemischen Industrie zu erhalten. (lacht)
Autor
Daniel Timme
Mai 2019
Kontakt
Daniel Timme
Hochschulkommunikation
+49.6151.16-37783
daniel.timme@h-da.de
Links
Zur Person
Martin Führ (Jahrgang 1958) ist Professor für Öffentliches Recht, Rechtstheorie und Rechtsvergleichung im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der h_da.
Er lehrt unter anderem in den Studiengängen Informationsrecht, Energiewirtschaft und RASUM sowie dem Begleitstudium SuK und leitet die Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse (sofia).
Nach dem Studium an der Goethe-Universität in Frankfurt/Main arbeitete Führ von 1983 bis 1993 beim Öko-Institut e.V., wo er seit 1998 Mitglied im Wissenschaftlichen Kuratorium ist. 2002 habilitierte er sich an der Goethe-Universität mit der Schrift „Eigen-Verantwortung im Rechtsstaat“.
Eine erste Vertretungsprofessur an der damaligen FH Darmstadt hatte er bereits 1990; seit 1994 ist er fest an der h_da.
Führ wirkt maßgeblich an den Initiativen i:ne und s:ne sowie dem im Aufbau befindlichen Promotionszentrum Nachhaltigkeitswissenschaften (p:ne) mit.
Zwischen 2008 und 2015 war Führ von der Europäischen Kommission ernanntes Mitglied im Verwaltungsrat (Leitungsgremium) der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA/Helsinki). 2016 bestellte ihn der nach dem VW-Abgasskandal eingesetzte Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages zum juristischen Sachverständigen.
2017 verlieh die h_da ihm den Wissenschaftspreis in der Kategorie „Outreach“.
