"Was bin ich wert?"

Für viele von uns sind Instagram, Twitter oder Facebook heute fester Bestandteil der Alltagskommunikation. Wie soziale Medien den Blick auf uns selbst beeinflussen, untersucht Prof. Dr. Katrin Döveling, Professorin für Kommunikationswissenschaften und Medienkommunikation an der Hochschule Darmstadt (h_da) am Beispiel der Körperwahrnehmung junger Frauen. Ihre Forschungsergebnisse machen deutlich: Je intensiver der Social-Media-Konsum, desto schlechter ist häufig das Selbstwertgefühl. Viele junge, vor allem weibliche Nutzer befinden sich in einem Kampf um das vermeintlich perfekte Bild von Schönheit, um den „perfekten“ Körper.
Von Nadine Bert, 24. November 2020
Mit weltweit über einer Milliarde aktiver Nutzerinnen und Nutzer gehört Instagram heute zu den beliebtesten Social-Media-Plattformen. In Deutschland besitzt beinahe jeder Fünfte einen Account. Mehr als die Hälfte der jungen Erwachsenen zwischen 19 und 29 Jahren ist täglich, wenn nicht gar stündlich auf der Bildplattform aktiv. Dabei sind sogenannte Instagram Stories – Fotos oder Video-Clips, die nach 24 Stunden wieder verschwinden – besonders beliebt. Die Posts dienen dabei weniger der Vermittlung von Nachrichten im eigentlichen Sinne. Vielmehr sind sie Mittel zur Selbstinszenierung. Fitness-Influencer, wie die aktuell in Deutschland besonders erfolgreiche Pamela Reif, setzen dabei vor allem auf ihren eigenen Körper. Täglich können ihre rund 6,5 Millionen Follower verfolgen, wie ein vermeintlich perfekter Körper aussehen sollte. Mit der steigenden Beliebtheit solcher Angebote, wächst auch der Einfluss auf deren Nutzerinnen und Nutzer. Diesen Zusammenhang untersucht Professorin Katrin Döveling in ihren aktuellen Studien: „Mich interessiert, wie sich Jugendliche und junge Erwachsene heute definieren und welche Auswirkungen solche Social-Media-Angebote auf ihr Selbstbild, ihre Gefühle, Gedanken und Verhalten haben“, erklärt Döveling.
Trugbilder werden zu Leitbildern
Täglich landet eine Vielzahl von Bildern scheinbar perfekter Menschen auf den Smartphones und schließlich in den Köpfen der User. Auch wenn sie überwiegend Trugbilder zeigen, poliert durch moderne Bildbearbeitung, können wir uns kaum gegen ihren Einfluss wehren, sagt Döveling. Welche Spuren die permanente Selbstdarstellung und der permanente Vergleich insbesondere bei jungen Frauen hinterlassen, untersucht die Professorin seit einigen Jahren in einer Studienreihe. Neben der Analyse von Bildinhalten erfolgreicher Fitness-Influencer-Accounts betreute sie im Rahmen einer Abschlussarbeit die Durchführung von Online-Befragungen bei rund 900 jungen Frauen und Männern. Im Fokus stand die Wirkung von Fitnessinhalten auf Instagram auf das Körperbild der Nutzerinnen und Nutzer. Konkret ging es um die Aspekte sozialer Vergleich, empfundener Druck, Diätverhalten und Selbstbewusstsein.
Mehr als 50 Prozent der überwiegend weiblichen Befragten im Alter von durchschnittlich 21 Jahren gaben an, sie fühlten sich von den Bildern unter Druck gesetzt und in ihrem Selbstbewusstsein negativ beeinflusst. Zwar geht es bei rund der Hälfte der analysierten Posts scheinbar um Themen wie Sport und Ernährung. Tatsächlich aber steht die reine Körperdarstellung und -inszenierung im Vordergrund. „Man will selber so sein und hat dann eigentlich ein schlechtes Gefühl, dass man nicht so ausschaut“, kommentiert eine junge Frau, die an Dövelings qualitativer Befragung teilnahm. Die Ergebnisse zeigen auch: Je länger und häufiger Instagram aktiv genutzt wird, desto negativer empfinden die Nutzerinnen ihren eigenen Körper und beschäftigen sich beispielsweise eher mit Diäten, weil sie sich „zu fett“ fühlen.
Aussagen wie „Die sind von Natur aus so.“, „Die haben ein schönes Gesicht. Schauen mit 40 aus wie 20.“, „Bei denen ist quasi alles perfekt“, erklärt die Wissenschaftlerin so: „Es geht vor allem um Zugehörigkeit und Anerkennung. Im Vergleich mit anderen finden wir heraus, wer wir sind und wo wir auf der gesellschaftlichen Werteskala stehen.“ Dieser soziale Vergleich finde sowohl „nach oben“ als auch „nach unten“ statt – je nach gefühltem Ergebnis, wertet sich eine Person dann entsprechend entweder auf oder ab.
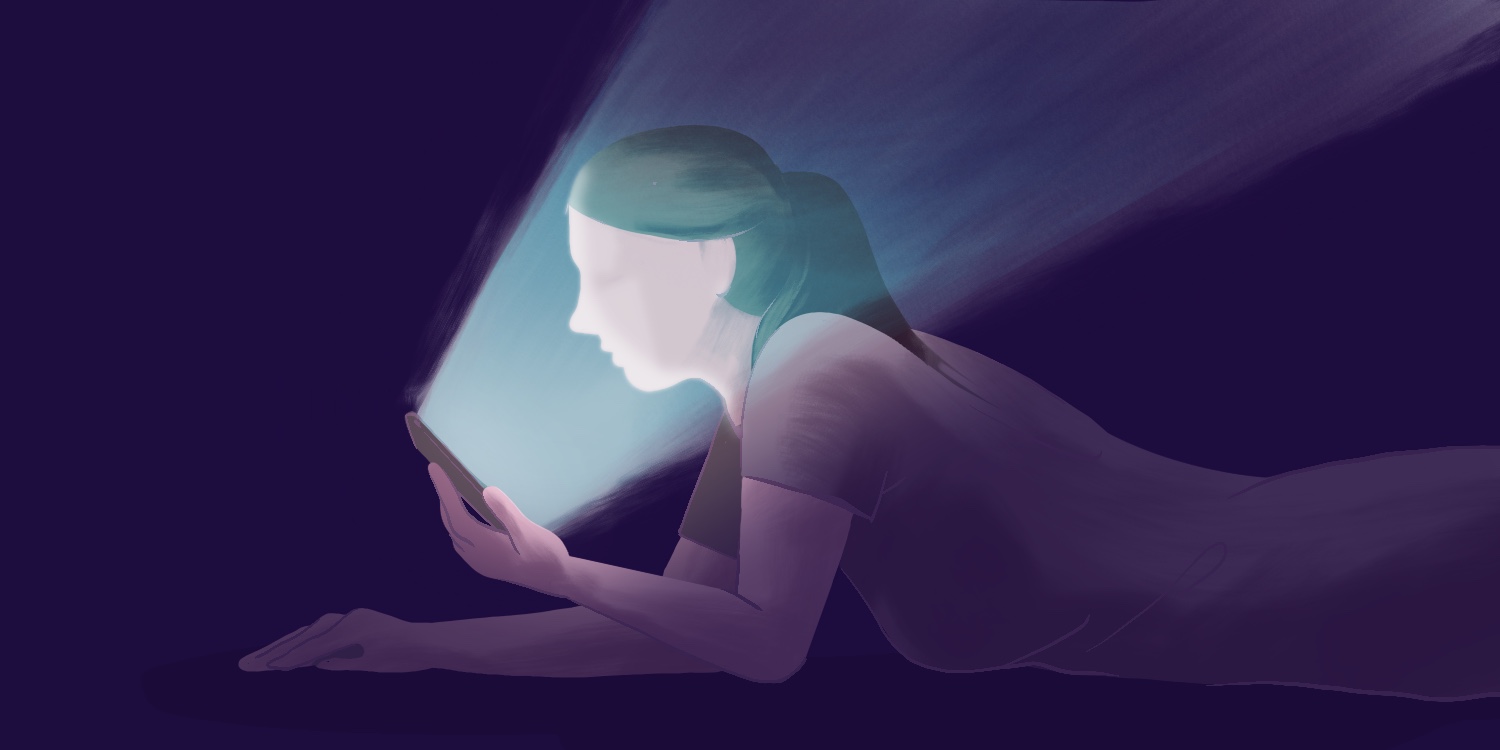
Der Begriff des Wertes sei hier ganz entscheidend, sagt Döveling. Auf Instagram werde das Aussehen, die normative Festlegung von Schönheit zur Ware mit einem gewissen Marktwert, an dem sich vor allem die Nutzerinnen orientierten. Bei einer idealisierten unrealistischen Bezugsgröße seien die negativen Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl jedoch unvermeidlich. Das zeige sich auch in der steigenden Anzahl plastisch-operativer Eingriffe bei jungen Frauen und in einem regelrechten Schlankheitswahn – gut zu beobachten in absurden Wettbewerben wie der unter dem Hashtag #thighgap, unter dem Frauen den Abstand zwischen ihren Oberschenkelinnenseiten zum Wettkampfgegenstand machten.
Vom „Body Shaming“ zur „Body Positivity“
Natürlich lasse sich Instagram nicht isoliert von anderen gesellschaftlichen Einflussfaktoren wie Elternhaus, Freundeskreis und anderen Medien betrachten, so Döveling. Doch alleine der Stellenwert und die Präsenz, die das Medium im Leben vor allem junger Frauen habe, lasse Rückschlüssen auf seine Relevanz zu. Junge Frauen, die bereits unsicher mit ihrem Körper sind, so lässt sich aus ihrer Studie schließen, stärker betroffen als solche, die nach eigener Aussage über ein gestärktes Verhältnis zu sich selbst verfügten.
Die Ergebnisse der Inhaltsanalysen und Befragungen belegen, dass die Omnipräsenz der Instagram-Scheinbilder den Bezug zur Realität verblassen lässt. Dadurch fällt es jungen Frauen schwer, ein positives Gefühl für ihren Körper zu entwickeln. Stattdessen schämen sie sich für ihre vermeintliche Unvollkommenheit. Unweigerlich stellt sich da die Frage, wie die Männer mit dem digitalen Einfluss umgehen? „Männer begegnen dem eher mit einer guten Portion Selbstironie und Humor“, berichtet Döveling. „Zwar wird der Waschbrettbauch auf Instagram bewundert, das eigene ‚Bierbäuchlein‘ aber belustigend und mit Wohlwollen betrachtet.“ Die Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass das Selbstwertgefühl von Männern auch heute noch weniger an Äußerlichkeiten ausgerichtet ist.
Zwar gibt es aktuelle Strömungen, die die Unvollkommenheit zum neuen Ideal stilisieren und das „Sich-Wohlfühlen-mit-dem-eigenen-Körper“ propagieren – ein Trend, den man als Body Positivity bezeichnet. Jedoch kritisiert Döveling, dass auch hier weiterhin nur Äußerlichkeiten im Vordergrund stünden. „Ich möchte gerne dafür appellieren, dass wir stattdessen mal eine Debatte über soziale Fähigkeiten wie Empathie oder über ein gesundes Miteinander führen.“
Angriff auf das gesellschaftliche Wertesystem
Nicht nur die jungen Frauen selbst gehen häufig hart mit sich ins Gericht – auch andere, häufig ebenfalls Frauen, missbrauchen Kommentarfunktionen und Dislike-Buttons zur Diskreditierung. Cyber-Mobbing ist ein weit verbreitetes Phänomen, das seine Opfer häufig in die emotionale Isolation treibt. Für die „Täter“ hingegen wird die Hemmschwelle, allgemeine gesellschaftliche Normen zu brechen, dadurch reduziert, dass sie im Netz in die Anonymität abtauchen können. Auch der US-Wahlkampf sei ein Beispiel dafür gewesen, wie sich die digitalen Grenzverletzungen in unsere reale Welt verlagern, so Döveling.

Dieser Entwicklung müsse man vor allem im sozialen Umfeld der Heranwachsenden entgegenwirken: „Ich sehe insbesondere das Elternhaus und die Schule in der Verantwortung, den jungen Erwachsenen das richtige Rüstzeug wie ein gesundes Selbstwertgefühl und eine starke Medienkompetenz mit auf den Weg zu geben.“ Doch die Forscherin sieht auch die Schwierigkeiten: „Aktuell sind Elternhaus und Schule den ‚Digital Natives‘ meist haushoch unterlegen. Viele Eltern wissen nicht, wo und wie sich ihre Kinder in den sozialen Medien bewegen, und vielen Lehrern fehlt es ebenfalls an den entsprechenden Einblicken in die digitale Welt der Jugendlichen. Da gibt es viel Nachholbedarf“, so Döveling. Für sie ist das Erlernen des richtigen Umgangs mit sozialen Medien und das Vermitteln von Regeln für die digitale Kommunikation genauso wichtig für das emotionale Wohlbefinden der Jugendlichen wie Sport für die körperliche Gesundheit. Eltern und Lehrer sollten dafür sensibilisiert werden, was Kinder und Jugendliche im digitalen Raum erleben, denn dieser sei nicht mehr isoliert zu betrachten, sondern integraler Bestandteil der Lebenswirklichkeit der Heranwachsenden. Daher sei es wichtig, dass vor allem Eltern mit ihren Kindern über deren Erleben und Gefühlswelt in Bezug auf digitale Inhalte sprechen und aktiv diskutieren. „Wir leben nun mal in einer digitalen Gesellschaft – davor können wir nicht die Augen verschließen“, meint Döveling.
Doch die Professorin sieht auch positive Aspekte. Gerade während der aktuellen Corona-Pandemie zeigten sich diese deutlich: „Es ist ein Segen, dass man sich in der aktuellen Situation wenigstens digital ‚treffen‘ kann. Wir sind soziale Wesen und als solche auf den Kontakt mit anderen angewiesen“, erklärt Döveling. „Und wenn wir alle hin und wieder mal der Angst widerstehen, etwas zu verpassen, und Handy und Computer mal ausschalten – also digital detoxen –, fällt es auch leichter, sich auf diese positiven Aspekte zu konzentrieren.“
Digitale Welt und Emotionen im Forschungskontext
Die Auswirkungen medialer Kommunikation auf unsere Emotionen beschäftigten die Professorin schön früh. Bereits als Studentin der Psychologie, Soziologie und Medienwissenschaft bemerkte sie, dass das Thema im Studienplan unterrepräsentiert war. Mit dem Tod Prinzessin Dianas im Jahr 1997 rückten diese Fragestellungen dann erstmals in den Fokus ihrer Forschung: Als Stipendiatin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) an der UC Berkeley analysierte Döveling die Prozesse kollektiver Trauer weitergehend vor dem Hintergrund medial vermittelter Emotionen in unterschiedlichen Kulturen. Neben Studien zu Trauerarbeit in den digitalen Medien, beispielsweise der Entwicklung sogenannter Trauer-Foren, weitete die Wissenschaftlerin ihre Untersuchungen zu Emotionen aus. So beleuchtete sie den Umgang mit Emotionen im Reality TV oder das Spannungsfeld von Empathie und Schadenfreude in digital geführten Debatten. In den vergangenen Jahren fokussierte sie ihre Forschung auf das Zusammenspiel von Mensch und digitaler Technologie. Das Kernthema: Emotionen im digitalen Zeitalter. Derzeit arbeitet Döveling an der zweiten Auflage ihres internationalen Handbuchs „Routledge Handbook Emotions and Media“.
Das Thema im Seminarangebot der h_da
Im Rahmen des Sozial- und Kulturwissenschaftlichen Begleitstudiums (SUK) am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der h_da bietet Professorin Katrin Döveling eine Reihe von Seminaren zum Thema an. In der Veranstaltung „Digital Self revisited: Vom Bodyshaming zu Body Neutrality“ geht sie mit ihren Studierenden der Frage nach einem positiveren Körperbild auf den Grund und untersucht dabei auch weiter die Bedeutung des Elternhauses, die Diskrepanz von gefühltem und digital dargestelltem Körperbild sowie das Fitness- und Diätverhalten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Zudem betreut sie eine Abschlussarbeit, die das Thema Body-Shaming und Online-Mobbing genauer unter die Lupe nimmt. Weitere Angebote sind das Seminar „Digital Emotions“ (Englisch), in dessen Rahmen sich die Studierenden mit der Komplexität der Emotionen in digitalen Welten anhand von Fallstudien befassen. „Wie schon erwähnt, scheint das Thema bei Männern noch nicht so präsent zu sein. Daher würde ich mehr männlichen Zulauf in meinen Seminaren sehr begrüßen“, appelliert Döveling augenzwinkernd. Dies scheint sie in diesem Semester schon erreicht zu haben. Aktuelle Stimmen von Studierenden zeigen: Ihre Leidenschaft für das Thema ist ansteckend.
Kontakt
Christina Janssen
Wissenschaftsredakteurin
Hochschulkommunikation
Tel.: +49.6151.16-30112
E-Mail: christina.janssen@h-da.de
Weiterführende Links
Das Thema in den Medien
taz, 8.11.2017: “Aufstand der Malerinnen”
Der Standard, 19.9.2017: Social Media und das mediatisierte Gefühl, nicht (schön) genug zu sein
