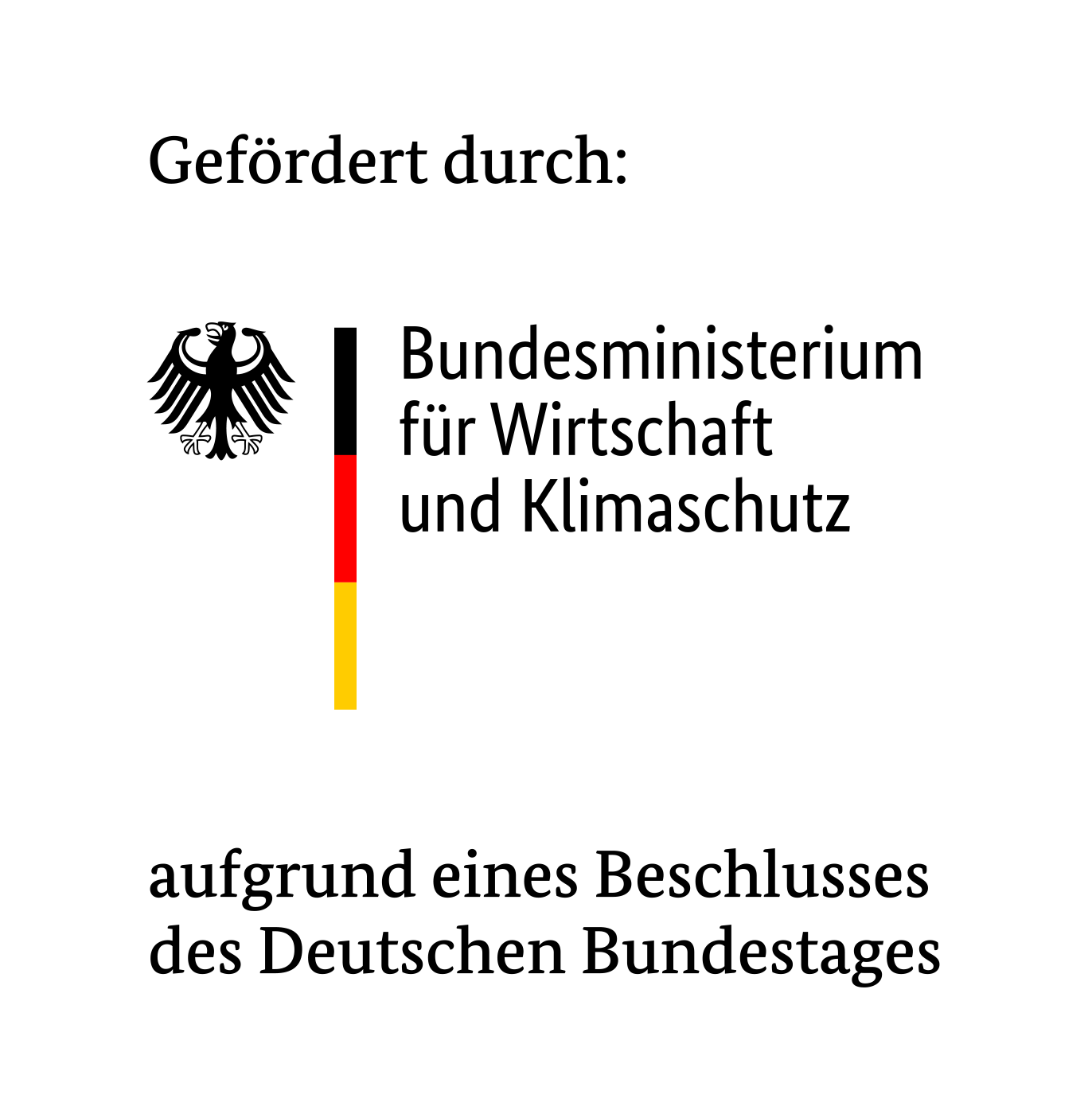Neues Verfahren zur Triebwerksreinigung von Flugzeugen
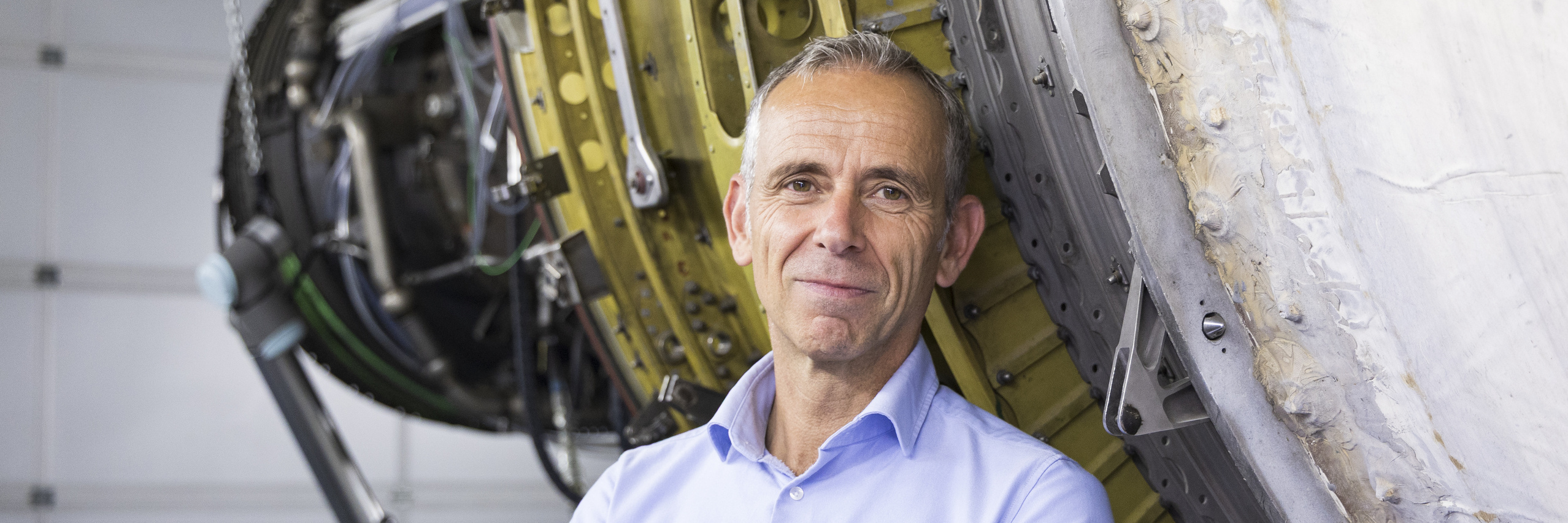
Schon hauchdünne Schmutzschichten haben große Auswirkungen. Lagert sich Dreck auf den Schaufeln von Flugzeugturbinen ab, bedeutet das mehr Kerosinverbrauch, zusätzliche Emissionen und eine kürzere Lebensdauer teurer Bauteile. Wissenschaftler der Hochschule Darmstadt forschen daher seit Jahren erfolgreich mit der Lufthansa Technik AG an neuen umweltschonenden und zeitsparenden Prozessen der Triebwerkswäsche. Das jüngste Forschungsprojekt von Maschinenbau-Professor Gerald Ruß hat ein neuartiges Reinigungsverfahren für die Heißgassektion, also Brennkammer und Turbine, ziviler Flugzeuge entwickelt. Das vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte Vorhaben wird aktuell für eine Patentanmeldung vorbereitet.
Von Astrid Ludwig, 7.7.2025
Die Schaufeln sind eher unscheinbar, nur wenige Zentimeter groß, aber irre teuer. Gerald Ruß, Professor am Fachbereich Maschinenbau und Kunststofftechnik der h_da, hält eine in Händen. „Die kostet neu mehrere tausend Euro“, berichtet der Experte für Kraft- und Arbeitsmaschinen und Wärmetechnik. In einer Flugzeugturbine bilden rund 70 davon den Schaufelkranz, durch den die heiße Abluft aus der Brennkammer fließt und für den Schub sorgt. In einem einzigen Triebwerk sind so fast ein Million Euro nur für diese Bauteile verbaut. Ihre spezielle Metall-Legierung, Form und Beschichtung machen die handgroßen Elemente so einzigartig und kostspielig.
Eine eigene Turbinenhalle
Der h_da-Professor steht in Gebäude C18 auf dem Campus der Hochschule in der Schöfferstraße. Die Turbinenhalle wurde 2011 eigens für Forschungsprojekte errichtet. Schon seit Beginn der Millennium-Jahre arbeiten Wissenschaftsteams der h_da mit der Lufthansa Technik AG zusammen. In bisher drei aufeinanderfolgenden Forschungsvorhaben ging es um wechselnde, neuartige Verfahren zur Triebwerksreinigung. Den Grundstein zu der Kooperation legte eine Abschlussarbeit 2005. „Damals hat unser Student Sebastian Giljohann den Ansatz eines wasserbasierten Verfahrens zur Triebwerksreinigung entwickelt“, sagt Gerald Ruß. Damit nahm die Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Studierenden der h_da mit Ingenieuren der Lufthansa Technik AG ihren Lauf. Die Lufthansa-Tochter bietet Dienstleitungen für die Wartung, Reparatur und Überholung an und unterhält am Frankfurter Flughafen einen Standort. Von der Hochschule Darmstadt mitentwickelte Reinigungsverfahren sind bereits weltweit in der Anwendung.
Seit 2018 ist nun das dritte gemeinsame Forschungsvorhaben erfolgreich angelaufen. Das Vorhaben zur „Entwicklung eines Reinigungsmodells für neuartige Reinigungsverfahren im Bereich der Heißgassektion von zivilen Flugtriebwerken“ – so der offizielle Titel und kurz HSC genannt – wurde vier Jahre lang vom Bundeswirtschaftsministerium mit fast zwei Millionen Euro gefördert. 1,1 Millionen Euro flossen dabei an die h_da. Auch diesmal arbeiten die Forschenden der h_da an Originalbauteilen und unter realen Betriebsbedingungen: In der Turbinenhalle steht das Strahltriebwerk einer Boeing 747-200, das über viele Jahre im Linieneinsatz bei verschiedenen Airlines im Einsatz war. Ruß, der früher für einen Triebwerkshersteller gearbeitet und gute Kontakte in die Branche hat, konnte den Kauf des ausrangierten Triebwerkes für die Hochschule in die Wege leiten. Die Dimensionen sind beeindruckend. Das Bauteil, das die verschiedenen Triebwerksstufen offenlegt, ist 4,65 Meter lang, fast vier Tonnen schwer und hat einen Durchmesser von 2,44 Meter. Das Aggregat nimmt fast die gesamte Halle ein.
Der riesige Fan (Gebläse) dominiert die Frontansicht. Hierüber wird die Luft angesaugt, die das Triebwerk für den Betrieb benötigt. „In einer Sekunde ist das das Luftvolumen eines Einfamilienhauses“, veranschaulicht Professor Ruß die enormen Mengen. Mit diesem Luftsog fließen aber gleichzeitig auch Staub, Pollen, Asche, Abgase oder Sand in das Innere des Triebwerkes – „je nach Bodennähe, Einsatzort oder auch Flugroute“, erklärt der Experte. Gelangt die verschmutzte Luft in die Brennkammer und die Turbine, wo Temperaturen von über tausend Grad herrschen, schmelzen die Partikel und lagern sich als dünner Film auf der Oberfläche der Schaufeln ab. „Das verändert die Aerodynamik und den Wirkungsgrad und der Kerosinverbrauch steigt, was wiederum den Ausstoß von Emissionen erhöht und die Lebensdauer der Bauteile verkürzt“, erklärt Ruß.
Reinigung der „Hot Section“
Im normalen zivilen Flugbetrieb müssen die Triebwerke daher regelmäßig und flugroutenabhängig gewartet und gereinigt werden. Das ist für die Airlines aufwendig und teuer, vor allem wenn es um die Säuberung des Heißgas-Bereiches mit Brennkammer, Hochdruckturbine, Niederdruckturbine und Düse geht – die sogenannte Hot Section. Um genau diesen Bereich dreht sich das jüngste Forschungsprojekt der Hochschule zusammen mit der Lufthansa Technik AG. „Bisher ist die Reinigung der Hot Section für die Fluggesellschaften nur möglich im Rahmen einer teuren, großen Inspektion, bei der die Maschinen aus dem Flugbetrieb genommen und die Triebwerke vom Flügel abmontiert werden müssen“, erläutert der Professor. Ziel der h_da-Forschung ist dagegen die Wartung und Reinigung während eines normalen, kleineren Checks, bei dem das Triebwerk an Ort und Stelle verbleiben kann – also unter „On Wing-Bedingungen“. „Wenn das gelingt, ist das für Airlines sehr lohnend“, sagt Ruß.
Die Bauteile der sogenannten Hot Section sind allerdings schwer zugänglich. Die Forschenden haben sich in dem Projekt daher gezielt auf die Reinigung über die Inspektionsöffnungen konzentriert, um die aufwändige Demontage von Bauteilen und Verkleidungselementen zu umgehen. Die Inspektionsöffnungen sind rund acht bis zehn Öffnungen, die aussehen wie handtellergroße Schrauben. „Die Kunst besteht darin, das Reinigungsmittel über diese Öffnungen zu injizieren“, sagt der Maschinenbau-Professor. Per Hand ist das schwierig, weshalb sein Wissenschaftsteam einen Roboterarm konstruiert und programmiert hat, der die Reinigung automatisch vornehmen soll.
Ein Konzept mit Potenzial
„Wir haben zahlreiche Reinigungsmöglichkeiten gescannt“, berichtet er. Darunter die Säuberung per Blitzlicht, Laser, Wasser, Trockeneis oder auch Plasmastrahl. Das h_da-Team hat analysiert, welche Mittel oder womöglich Reinigungsmittel-Kombinationen wirken und ob dabei eventuell Bauteile beschädigt werden. „Wir haben ein Konzept erarbeitet, das Potenzial zeigt“, sagt Professor Ruß. „Was wir entwickelt haben, hat im ersten Versuch unter realitätsnahen Bedingungen vielversprechende Ergebnisse gezeigt.“ Es wäre eines der ersten Verfahren dieser Art in der kommerziellen Luftfahrt. Einzelheiten darf er aus Verschwiegenheitsgründen aber nicht nennen, da eine Patentanmeldung geprüft wird.
Nur so viel verrät er: Das eigentliche Reinigungsprozedere dauert nicht länger als 20 Minuten. Deutlich schneller als bisher könnten Triebwerk und Flugzeug wieder in Betrieb gehen. Das wäre ein enormer Fortschritt und eine Zeitersparnis für die Airline. Triebwerke könnten so öfter und unkomplizierter gereinigt werden, wären sauberer und sparsamer. Gereinigte Maschinen brauchen weniger Treibstoff. „Das würde - allein bezogen auf die deutschen Airlines - einige hunderttausend Tonnen CO2 Emissionen weniger im Jahr bedeuten“, betont Gerald Ruß. Die anwendungsbezogene Forschung der Hochschule Darmstadt sieht er daher auch als Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz.
Kontakt zur h_da-Wissenschaftsredaktion
Christina Janssen
Wissenschaftsredakteurin
Hochschulkommunikation
Tel.: +49.6151.533-60112
Mail: christina.janssen@h-da.de
Fotografie: Samira Schulz
Infos zum Studium
Übersicht über die Studiengänge:
fbmk.h-da.de/studienangebot/uebersicht
Fachbereich Maschinenbau und Kunststofftechnik: fbmk.h-da.de/
Links
impact, April 2019:
“Strahlend sauber”
Video Science Reporter, 2023:
„Synthetische Kraftstoffe“